
Vom Mythos des Realen
Als das Magazin „Tempo“ Mitte der achtziger Jahre gegründet wurde, lag eine neue publizistische Grundidee in der Luft, ein Kunstgriff, der später auch dem „SZ Magazin“ eine unverwechselbare Handschrift geben sollte: Kluge Köpfe schreiben über Gummibärchen genauso wie über Helmut Kohl, Hollywood, Kalaschnikows, verschmutzte Meere, das Sexleben von Tauben, Gucci, Pop und Politik.
Dies sollte zehn Jahre später das Hirnfutter für eine neue Generation von Lesern liefern: die popkulturellen Nerds, die ihre Privatwelten zum ganz grossen Universum erklärten und bald mit der totalen Selbstanalyse des realen und medialen Alltags die Macht der Bloggersphäre und Social Networks begründeten.
Den Etablierten gab das natürlich schwer zu denken. Bald übernahmen „Bild“, „Spiegel“, „FAZ“ und die vielen anderen auch dank der Mithilfe ehemaliger „Tempo“-Macher und -Bewunderer den „Tempo“- Kunstgriff und etablierten ihn in ihren Publikationen. Das Geheimnis des Erfolgs waren einmal mehr die alten Dada-Gefechte um das lustig aufgeblasene Nichts oder das absurd kleine Detail, das bloß wirkungsvoll inszeniert werden musste. Dabei ist das Produkt oder der Stoff natürlich nie so wichtig wie das Image des Produkts oder des Stoffes.
Es geht bei dieser publizistischen Grundidee immer darum, dass das Image wie die Fahne des Eroberers überall aufgepflanzt ist, wo jemandes Blick hinfallen kann. Das hatten die besten „Tempo“-Autoren immer gnadenlos gut kapiert. Heute kapieren es auch Zehnjährige und die Großeltern auf Facebook.
Illusionismus, 20 Jahre später
Wir sind in die vom Schein beherrschte Welt der Postmoderne hineingeboren worden, deren bestimmendes Element die Show ist. In der Show gibt es keine Wahrheit, sondern Effekte. Je brillanter die Show ist, umso überzeugender ist sie gelungen und desto begeisterter werden die Leser- und Zuschauermassen sein. Selbst die vorsichtigsten Journalisten renommierter Zeitungen begannen in den Neunzigern, Teile dieser Idee zu übernehmen – die Zauberei, den Illusionismus, die herablassende Coolness, die moralisierende Ironie, das Pop-Element, das wird heute von „Spiegel Online“, von der „Weltwoche“ bis zum „Böblinger Tagblatt“ beherrscht. Bloß verkauft man es ein bisschen pseudoseriöser. Zurückhaltender.
Dem „Spiegel“ gegenüber hatte ich mal kurz nach dem Skandal von einer „Implosion des Realen“ gesprochen – natürlich unter schwerem öffentlichen Druck, eine Stellungnahme abzugeben, irgendwann nach Mitternacht, Pacific Time am Telefon. Das klang gut, aber ich hätte wissen sollen, dass das als Entschuldigung nicht ausreicht.
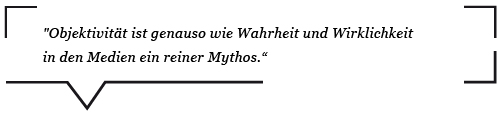
Dass ich die Wahrheit sagte, darauf kam niemand: Meine journalistische Erfahrung war immer die, dass mit dem Auftauchen von Journalisten die Wirklichkeit implodiert. Ich habe das immer wieder gesehen, ob in der Wartestellung auf den ersten Golfkrieg im Intercontinental-Hotel von Amman, wo die Wirklichkeit von isolierten Journalisten choreographiert wurde. Oder in den Armenvierteln von Lima, wo ich für „Tempo“ über die Auswirkungen der Cholera recherchiert habe und die Familien beim Auftauchen meiner Fotografin ihre Hütten zu säubern begannen und sich frische Kleider anzogen und lächelten und lächelten und lächelten. Erst als die Fotografin während zwei Stunden vielleicht vierhundertmal ihre Kamera auf die Opfer abgefeuert hat, bekam sie endlich das gnadenlose Bild, das die Bildredaktion gefordert hat.
Objektivität ist genauso wie Wahrheit und Wirklichkeit in den Medien ein reiner Mythos. Ich finde, Journalismus kann nur dann Vertrauen zurückgewinnen, wenn die Macher ihren Lesern gegenüber ganz offen zugeben, dass es beim Informationsauftrag, neben der reinen Informationsbeschaffung, um total differierende Wirklichkeitsentwürfe geht.
Die neuen Heilsbringer unter den Chefredakteuren, denen die Krise und das neue Sicherheitsdenken natürlich gut ins Konzept passen, Leute wie zum Beispiel mein Ex-Kollege und Förderer Roger Köppel bei der „Weltwoche“ versuchen ja mit jedem Trick, das Konzept der Objektivität zu rehabilitieren. Mit dem alten Verweis auf angelsächsische Tugenden definiert so jemand Objektivität natürlich nicht als Ritual, als Inszenierung oder als reine Konstruktion – wie noch zu Zeiten, als er meine Storys auf die Titelseite setzte -, sondern als Zuschreibung von Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit für erfolgreiche Informationen. Mit solchen Strategien wird heute um das verloren geglaubte Vertrauen gebettelt und nebenbei der Leser hinters Licht geführt.
Das System Journalismus ist längst ausgefranst. Und Köppel versucht sich als Borderline-Provokateur, indem er eine rechtskonservative Position inszeniert, weil das heute am meisten Quote verspricht.
Armada von Authentizisten
Ich hatte in den vergangenen Jahren mehrfach Besuch vom hochdekorierten Journalisten aus Deutschland, England, aus der Schweiz und so weiter. Es waren nette Menschen, „Spiegel“-Reporter, Reporter von der Londoner „Times“, vom „Guardian“, der „NZZ“ und vom russischen Fernsehen, die für Reportagen recherchierten, Dokumentarfilme drehten, über mich, den schlimmsten, deutschsprachigen Journalisten aller Zeiten. Ich durfte also hautnah miterleben, wie sich mir Reporter menschlich nett präsentierten, geduldsam und intelligent interviewten, Fakten sammelten und was dann aus den riesigen Mengen an Recherchematerial, die ich geliefert hatte, für eine Geschichte entstand.
Das war faszinierend, amüsant und auch ein bisschen beängstigend. Das Resultat war eher bedrückend. Es war einfach nicht die Wahrheit. Es war weit entfernt von der Wahrheit. Es ist wirklich nicht mehr leicht, Journalist zu sein, dachte ich. Ich weiß wirklich nicht, ob man es immer noch erwähnen muss: Die Wirklichkeit besteht nicht bloß aus Nachrichten und Fakten, sondern auch aus Emotionen, Erregung, Abstraktion, Fantasie, Ästhetik, Psychedelik, Unerklärbarem, Einsamkeit, Unsicherheit und vielem mehr.
Man hat mich natürlich oft mit dem ehemaligen „New York Times“-Reporter Jayson Blair verglichen, und selbst die „Times“ wollte nach dem Film „Bad Boy Kummer“, der im Frühjahr 2011 in die Kinos kam, von mir eine Stellungnahme zu Blair. Ich habe abgelehnt, weil ich finde, man kann uns nicht vergleichen. Ich habe immer eine besondere Verantwortung gespürt, wenn ich auf Sozial- und Politreportagen angesetzt wurde. Ob die Tamile-Tigers in Sri Lanka, Cholera in Peru, Hundekämpfe in Hamburg oder die Kokabauern in Bolivien.
Die Verantwortungsgefühle wurden natürlich oft durch das beschränkte Budget torpediert. Das Budget, das einem Journalisten bei seinen Recherchen zur Verfügung steht, verändert die Wirklichkeit. Wer einen Monat eine Hütte mit Kokabauern in Bolivien beobachtet, um herauszufinden, was da läuft, kann auf andere Ergebnisse kommen als jemand, dem man vier Tage Zeit gibt, Text und Bild zu liefern. Viel wichtiger erscheint mir noch eine andere Erkenntnis: dass, wenn man unter Druck steht oder das Geld für aufwändige Recherche vor Ort fehlt, man sich dann auch einfach Bilder von Hütten und Kokabauern in Bolivien besorgen kann, um die Landschaft und Dörfer zu beschreiben.
Courtney Love und ihre Brüste
Darin sehe ich keinen Schwindel. Man kann lokale Autoren lesen und das Thema per Internet präzise recherchieren, und wenn man über schreiberisches Talent verfügt, dann sollte es möglich sein, nicht bloß Authentizität zu suggerieren, sondern auch eine einleuchtende Botschaft zu liefern. Und mit so einem Text kommt man einer tieferen Wahrheit manchmal sehr viel näher, als jemand, der aufwändig vor Ort recherchiert hat und dabei auch unter Zwang steht, seine Gefühle und Visionen dem recherchierten Material und der vorgefundenen Wirklichkeit und Unwahrheit unterzuordnen.
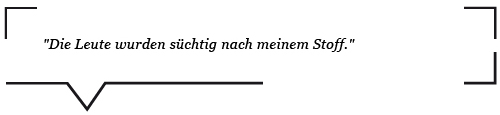
Was mir heute im deutschsprachigen Journalismus fehlt, sind jene Starporträts oder Interviews, die auf einer total abgehobenen Metaebene stattfinden und einem dabei mehr über das Leben erzählen als sämtliche Leitartikel, die, sagen wir mal, Helmut Markwort jemals geschrieben haben. Es gab ja schon einen tieferen Grund, wieso ich über Stars wie Brad Pitt geschrieben habe, dass ihnen zum Beispiel ständig etwas aus der Nase hängt oder warum Courtney Love mit ihren Brüsten spielt und wieso man einen Star wie Nicolas Cage fragen sollte, ob er einen bayrischen Obstverkäufer namens Hans Epp kennt.
Es gibt gewaltige Unterschiede zwischen dem journalistischen Glaubenssystem eines Reporters, der Aufklärungs- oder Informationsjournalismus betreibt, den Strategien eines Interviewers, der im Entertainment-Milieu operiert, sich mit dem Interviewten verbrüdert und 100 Fragen stellt, oder der gnadenlosen Hofberichterstattung von Werbe- und PR-Journalisten.
Coole Herablassung
Ich würde gerne zugeben, dass ich schon nach meinem allerersten Star-Interview mit Bruce Willis im Frühjahr 1993 zu der Erkenntnis gelangt bin, dass es sich nicht lohnt, diese schöne, neue Welt mit der Gattung Interview zu erobern – höchstens als großartige Recherche für einen satirischen Roman oder sonst was aus der Position der coolen Herablassung. Das hätte mir eine ganze Menge Ärger erspart. Leider kam es anders. Die Leute wurden süchtig nach meinem Stoff.
Es ging damals darum, unsere journalistische Zukunft, die auf Erfolgskurs war, abzubremsen. Da kamen die Krise und mein Fall natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Begriff Borderline- oder Pop-Journalismus wurde von Authentizisten und Langweilern immer wieder aufgenommen, um uns zu diskreditieren. Dieser Begriff ist Unsinn. Ich persönlich wurde sogar zum Borderline-Charakter erklärt, zu einem „Dostojewski-Charakter“.
Klar fände ich – und die ganze Kummer-Familie – es heute schön, wäre ich für irgendetwas Seriöses berühmt geworden, etwas, das die Menschheit weiterbringt. Aber ich bin berühmt, weil ich Interviews mit Stars teilweise inszeniert habe. Dabei waren meine Absichten immer seriös und ernst gemeint. Es ging nie darum, Leser zu verarschen. „Tempo“-Journalisten wollten etwas Neues. Eine Neudefinition von Realität im Journalismus stand für mich eigentlich schon Anfang der achtziger Jahre fest, als ich zum ersten Mal in Transatlantik veröffentlicht wurde. „Tempo“ war dann also die Romantik zur Aufklärung von ’68 und zur Vorbereitung auf den Sturz der alten Säcke in den Chefetagen. Mein Journalismus forderte das Ende des Showbiz- und Warenweltjournalismus heraus, war also auch als ein Neuanfang gedacht.
Richtig hat das aber keiner wissen wollen. Man hat mich einfach immer wieder auf einen Star angesetzt. Das war für mich Klarheit genug, dass die Chefredakteure über meine Arbeitsweise Bescheid wissen und meinen Stil goutieren. In München waren sie wohl alle wahnsinnig stolz auf ihre Kontakte in Hollywood und wollten nichts Genaueres wissen. Und sie wollten immer und immer wieder am Objektivitätsritual Interview festhalten, obwohl ich mich längst für das Porträt oder eine andere Form eingesetzt habe.
Natürlich ist es im Nachhinein ein Riesenfehler gewesen, mich damals nicht eindeutig mit meinem Chef, Freund und Förderer Ulf Poschardt über diese Dinge zu unterhalten. Aber schließlich kannte er meine Vergangenheit. Davon bin ich ausgegangen. Und dann gab es ja noch mein 1995 erschienenes Buch „Good Morning Los Angeles“, in dem mein Spiel mit journalistischen Wirklichkeiten ziemlich eindeutig beschrieben ist.

Man hätte mich ja wenigstens ab und zu über die Entstehung dieser Interviews einfach Reportagen schreiben lassen können. Das wäre bestimmt lustig gewesen. Aber den Jungs in München waren Starinterviews irgendwie zu heilig. Kann ich gut verstehen. Es ist ja auch ein monumentaler Moment, wenn sich Leute wie ich an den PR-Listenhaien vorbeimogeln und vor einen Star wie Nicole Kidman gelassen werden. Heute ist das kurze, belanglose Dokumentieren von Begegnungen mit PR-Agenten und dem ganzen Drumherum bei Interviews ja längst Standard – um so zu tun, als ob da wirklich alles mit rechten Dingen abläuft. Aber nichts ist damit bewiesen, was soll bloß bewiesen werden?
Ideologie der skeptischen Allwissenheit
Ob ich jetzt immer die Wahrheit schreibe? Natürlich müssen die Fakten stimmen, und das war bei mir fast immer der Fall. Hinter der so genannten Wahrheit tun sich aber meistens Abgründe auf. So ist das Leben. Davon sollen die Leser erfahren. Mir ist es also sehr viel wichtiger, dass meine Botschaft rüberkommt. Darauf kommt es an.
Ich habe früher auch schon Reportagen geschrieben, da stimmten weder die Orte noch die Personen. Und trotzdem kam die Botschaft der Wahrheit wohl näher, als wenn ich mich auf die Leute eingelassen hätte, die mir entweder als PR-Bulldoggen an die Seite gestellt wurden oder sich als Informanten präsentierten. Natürlich rauche ich auch heute noch Joints, wenn ich zum Beispiel Bänder abhöre, oder ich spiele minimalistische Sounds ab oder höre die neue Maxim-Biller-CD, um mich zu stimulieren. Da passiert dann einiges mit meinen Recherchen. Und ich glaube, das ist auch gut so.
Der Weg zur Wahrheit führt über viele Wirklichkeiten. Das kann dem Leser keine Zeitung abnehmen. Ich glaube, das erwarten die Leute auch gar nicht mehr, dass sie ihre Zeitung aufschlagen, und da steht die Wahrheit schwarz auf weiß. Die Zeiten, als zum Beispiel der „Spiegel“ für die Wahrheit zuständig war oder jedenfalls so tat, dass er sie kennt, sind vorbei. Auch ein von sieben Faktenprüfern gechecktes „Spiegel“-Interview garantiert keine Wahrheit. Dabei war der „Spiegel“ ja mal meine einzige journalistische Ausbildung. Gerade seine kritische Haltung, oder was ich Mitte der Siebziger in der Schweiz dafür hielt, hat neben sprachlichen Eigentümlichkeiten und einer gewissen Radikalität bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Was mich wohl anfänglich beeindruckte: seine Ideologie der skeptischen Allwissenheit, die an allem zweifelt außer an sich selbst. Der „Spiegel“ hat es immer perfekt verstanden, so zu tun, als könne ihm niemand in der Welt irgendetwas vormachen.
Das beeindruckte. Besonders jene Leute, die total unwissend sind und gerne den Anspruch erheben, alles verstehen und aburteilen zu können.
Würde des Vorhandenen
Die „Spiegel“-Story hinterließ bei mir meistens bloß Pseudowissen, dafür aber auch starke emotionale Rückstände, die natürlich als Ressentiment wirksam wurden: Neid oder Schadenfreude. Für den Leser wurde also Woche um Woche eine Welt präsentiert, wo alle Sachverhalte prinzipiell als unbekannt dargestellt wurden. Erst ihr Auftauchen im „Spiegel“ verlieh ihnen dann so eine Art Würde des Vorhandenen, eine Wahrhaftigkeit. Die Wirklichkeit wurde zur Matrix des Magazins, die Story zu ihrem Phantom.
Natürlich hat das nicht nur bei diesem Magazin funktioniert. Mit Objektivität und Wahrheit hat das aber alles nicht viel zu tun. Der einzige Sinn und Nutzen journalistischen Kommunizierens kann heute also nur darin liegen, verschiedene Wirklichkeitsentwürfe zu produzieren.
Dieser Text ist eine aktualisierte Fassung eines Essays aus dem Medienmagazin „Cover“.
