
Die Zukunft der Zeitungen
Die Tageszeitungen sind bekanntlich in eine prekäre Lage geraten: Einerseits verlieren sie Leser und Inserenten im Printbereich, wobei die Hauptursache deren Abwanderung ins Internet ist. Andererseits gelingt es ihnen nicht, diese Verluste in der Online-Welt zu kompensieren. Die Frage, was die Bevorzugung des Internets erklärt und wie journalistische Websites zu gestalten wären, damit sie als Werbeumfeld attraktiv sind und die Zahlungsbereitschaft der Nutzer wecken, bewegt derzeit die ganze Branche.
 Zwei Bücher wollen bei der Suche nach einer Antwort behilflich sein – das Vorgehen der Autoren ist jedoch grundverschieden. Typisch für die Art, wie in der Zeitungsbranche selbst nachgedacht wird, ist der Band „Medienzukunft und regionale Zeitungen“.
Zwei Bücher wollen bei der Suche nach einer Antwort behilflich sein – das Vorgehen der Autoren ist jedoch grundverschieden. Typisch für die Art, wie in der Zeitungsbranche selbst nachgedacht wird, ist der Band „Medienzukunft und regionale Zeitungen“.
In 14 Beiträgen beschäftigen sich Verleger, Journalisten, Berater, Politiker und Wissenschaftler mit der Zukunft der Tagespresse. Neuigkeitswert und Erkenntnisgewinn halten sich in Grenzen. Fast alle Beiträge sind eine Mixtur aus Marktdaten, Zitaten prominenter Verleger und Journalisten sowie vagen Vermutungen über Auswege aus der Krise, die – mal mehr, mal weniger sortiert – dargeboten werden.
Der Journalismus muss besser werden und sich stärker am Publikum orientieren. Das ist die sattsam bekannte Botschaft. Wie dies konkret geschehen sollte, wird kaum einmal näher erläutert. Die behaupteten Publikumserwartungen und empfohlenen Strategien werden wissenschaftlich nicht unterfüttert.
Nur in einem Beitrag wird eine empirische Studie vorgestellt: Der Autor, der zehn (!) regelmäßige Leser des Hamburger Abendblatts qualitativ befragt hat, schließt von deren Aussagen recht unbekümmert auf die Gesamtbevölkerung. Ansonsten scheint nur das Rieplsche Gesetz bekannt zu sein, das im Jahr 1913 formuliert wurde und in der Wissenschaft längst als überholt gilt. Dennoch wird es in vier Beiträgen zitiert.
Spiegel der Ratlosigkeit
Der Band spiegelt die in der Zeitungsbranche herrschende Ratlosigkeit und den Mangel an Mitteln, die Krise zu bewältigen. Deshalb gleich weiter zum zweiten Buch. Ursina Mögerle geht in ihrer Züricher Dissertation die Sache ganz anders an. Ihre Kernfragen lauten: Werden Print-Zeitungen zunehmend durch ihre Online-Ausgaben substituiert? Und wie lässt sich die Wahl von Print- und Online-Zeitung erklären?
Vorhersehbar ist der Einwand von Praktikerseite, dass die Arbeit schwer zu lesen ist, mit über 400 Textseiten zu dick ist und am Ende keine einfachen Regeln bereit hält. Der Vorwurf der mangelnden Eingängigkeit wird gerne gegenüber kommunikationswissenschaftlichen Arbeiten erhoben. Wenn es um den eigenen Beruf geht, müssen Analysen vor allem leicht verständlich und unterhaltsam präsentiert werden – gerade so, als ob über den Journalismus nur journalistisch geschrieben und gesprochen werden darf.
Riepl war gestern
Mögerle gibt zunächst einen umfassenden Überblick über Ansätze zur Verdrängung und Ergänzung alter durch neue Medien. Dabei zeigt sie, dass das Fach längst weit über das – immer noch gerne zitierte – „Rieplsche Gesetz“ hinausgelangt ist, das völlig zu Recht als Marginalie auf knapp zwei Seiten abgehandelt wird. Mögerle greift sodann den Uses-and-Gratifications-Ansatz auf, den sie grundlegend diskutiert. Erhaltene Gratifikationen sollen – neben den Kosten – ausschlaggebend für die Mediennutzung sein, wobei angenommen wird, dass sich die Nutzung in einem Lernprozess an die wahrgenommenen Gratifikationen eines bestimmten Angebots anpasst.
Entsprechend der mikroökonomischen Nachfragetheorie geht Mögerle von einer Kosten-Nutzen-Maximierung aus. Dabei werden erhaltene Gratifikationen sowie monetäre und andere Kosten als Nutzen berücksichtigt. Auch das handlungstheoretische RREEMM-Modell nach Lindenberg und Esser lenkt den Blick auf die Kostenseite von Print- und Online-Zeitungen, die in der bisherigen Gratifikationsforschung zumeist ausgeblendet wurde.
Im „erweiterten funktionalen Modell der Substitution und Komplementarität“ werden die diversen Ansätze schließlich zusammengeführt: Substitution und Komplementarität zwischen Print- und Online-Zeitung sollen durch „Ressourcen“ erklärt werden. Zu diesen wurden inhaltliche Gratifikationen, strukturelle, das heißt medienspezifische Gratifikationen, strukturelle Restriktionen (Kosten) sowie längerfristige Themeninteressen gezählt, die gemäß der „The-more-the-more“-Regel zu einer vermehrten Nutzung beider Medien führen sollen, was sich allerdings nicht bestätigte.
Die Kosten-Nutzen-Bilanzierung wurde einerseits durch die „totale Online-Print-Differenz“ ermittelt, zum anderen über den Grad der Ähnlichkeit der einzelnen Gratifikationen und Restriktionen.
Warum Print, warum Online?
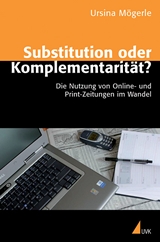 Gegenüber früheren Studien, deren Schwächen Mögerle systematisch herausarbeitet, hat ihre eigene empirische Untersuchung mehrere Stärken: Statt sich mit Aggregatdaten und einer Querschnittserhebung zu begnügen, hat sie die Nutzungs-Veränderungen im Rahmen einer Panelstudie auf individueller Ebene im Längsschnitt (innerhalb eines Jahres) erhoben. Außerdem sollte durch Nutzen- und Kostenerwägungen der Leser erklärt werden, weshalb Leser die Print- oder die Online-Variante ihrer Tageszeitung bevorzugen.
Gegenüber früheren Studien, deren Schwächen Mögerle systematisch herausarbeitet, hat ihre eigene empirische Untersuchung mehrere Stärken: Statt sich mit Aggregatdaten und einer Querschnittserhebung zu begnügen, hat sie die Nutzungs-Veränderungen im Rahmen einer Panelstudie auf individueller Ebene im Längsschnitt (innerhalb eines Jahres) erhoben. Außerdem sollte durch Nutzen- und Kostenerwägungen der Leser erklärt werden, weshalb Leser die Print- oder die Online-Variante ihrer Tageszeitung bevorzugen.
Bisher wurden die Nutzung oder die Wahrnehmung zumeist getrennt erfasst; nur in wenigen Fällen wurde versucht, die substitutive oder komplementäre Nutzung durch die Wahrnehmung des Nutzens und der Kosten zu erklären.
Mögerle hat in den Jahren 2006 und 2007 die Nutzer von neun Online-Zeitungen in der Deutschschweiz nicht-repräsentativ befragt; 1831 Personen nahmen an beiden Wellen teil. Wo liegen die besonderen Vorteile der beiden Zeitungs-Varianten? Sowohl bei der allgemeinen Informationsorientierung, das heißt beim Nachrichten-„Update“ im Tagesablauf, als auch bei der gezielten Informationssuche schnitt die Online-Zeitung besser ab als die Print-Zeitung.
Dagegen ergab sich weder bei der Unterhaltung noch bei der Sozialfunktion ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Varianten. Während also die Online-Zeitung bei den inhaltlichen Gratifikationen überlegen war, so war dies die Print-Zeitung bei den strukturellen Gratifikationen, und zwar wegen ihrer Flexibilität, besonderen Haptik sowie der besseren Möglichkeit, sich vertieft zu informieren oder zufällig etwas zu finden.
Bequeme Online-Angebote
Nur in puncto Bequemlichkeit schnitt die Online-Zeitung besser ab. Die Restriktionen wurden bei der Online-Zeitung als signifikant höher eingeschätzt, vor allem wegen des höheren kognitiven Aufwands.
Entscheidend für den Wert der Arbeit sind nicht solche konkreten Befunde, die Praktiker sicher nicht in jedem Punkt überraschen werden, sondern vielmehr der Nachweis, dass ihr Denkansatz fruchtbar ist. Die theoretische Vorannahme, dass die Print-Online-Bilanz aus Gratifikationen und Restriktionen die Nutzung erklären kann, bestätigte sich an mehreren Stellen: Jene Befragten, die seit Beginn der Online-Nutzung die Printlektüre reduziert hatten, erhielten in allen Kategorien mehr Gratifikationen durch die Online-Zeitung und nahmen hier auch weniger Restriktionen wahr.
Das gleiche Resultat zeigte sich auch innerhalb des Untersuchungszeitraums: Gratifikations- und Restriktionswahrnehmungen veränderten sich parallel zur Nutzungsveränderung. Die totale Online-Print-Differenz fiel bei den Doppel-Nutzern zwar leicht zu Gunsten der Print-Version aus; sie verschob sich allerdings zwischen den beiden Befragungswellen signifikant zu Gunsten der Online-Zeitung, ebenso ihre Nutzung und die Bereitschaft, auf die Print-Zeitung zu verzichten.
Die vollständige Print-Online-Bilanz besaß einen signifikanten Einfluss auf Veränderungen des Print-Online-Nutzungsverhältnisses. Das heißt: Je mehr Gratifikationen und je weniger Restriktionen die Online-Zeitung einem Nutzer bot, desto mehr nahm seine Online-Nutzung relativ zur Print-Nutzung zu. Dieser Zusammenhang ließ sich jedoch nicht für die einzelnen Gratifikationen und Restriktionen nachweisen.

Auch für die selbsteingeschätzte Substitution (Bereitschaft zum Verzicht) konnte dieser Zusammenhang zwar allgemein festgestellt werden, aber ebenfalls nicht für die speziellen Kategorien – mit einer Ausnahme: Falls der haptische Aspekt und die Unabhängigkeit der Print-Zeitung von einem technischen Gerät eine geringe Rolle spielten, wurde zunehmend auf die Print-Version zu Gunsten der Online-Version verzichtet. Mögerle zeigt einen Weg auf, wie die Angebotswahl durch Kosten-Nutzen-Erwägungen erklärt und prognostiziert werden kann.
Mögliche Erweiterung
Dieses Vorgehen ließe sich weiter verfeinern: Eine Erweiterung des Untersuchungsdesigns könnte darin bestehen, den Einfluss konkreter Angebote und nicht nur von Zeitungstypen zu berücksichtigen. Dabei wäre inhaltsanalytisch zu erfassen, wie Print- und Online-Angebot eines Zeitungstitels zueinander positioniert sind, das heißt, welche cross-mediale Strategie verfolgt wird. Es dürfte zum Beispiel einen Unterschied machen, ob auf einer Zeitungs-Website im Wesentlichen Printinhalte zweitverwertet werden oder ob neue Online-Inhalte geschaffen werden, die den Präsentations- und Rezeptionsbedingungen des Mediums angepasst sind. Auch der Grad der Exklusivität im Verhältnis zu anderen Zeitungsangeboten wäre zu berücksichtigen.
Schließlich wäre auch zu beachten, dass nicht nur Zeitungen aktuelle Informationen im Internet offerieren, sondern auch andere professionelle Anbieter (Websites von Zeitschriften und des Rundfunks, Nur-Internetanbieter wie Portale). Ob auch Laienangebote aus Sicht der Nutzer journalistisch relevant sind (Stichwort Bürgerjournalismus), wäre ebenfalls zu prüfen.
Kein reines Kosten-Nutzen-Kalkül
Natürlich hat der Versuch, das Nutzerhandeln rational zu erklären, Grenzen. Die Kritik am „homo oeconomicus“ trifft auch auf den Mediennutzer zu. Dass der Zeitungswahl kein reines Kosten-Nutzen-Kalkül zugrunde liegt, zeigt sich daran, dass auch der Zeitfaktor selbst, also ein Gewöhnungseffekt die Nutzung der Online-Zeitung verstärkte. Vermutlich ist dann, wenn sich eine neue Alternative zu einem alten Medium bietet, der Reflexionsgrad höher als in Normalphasen, in denen dies nicht der Fall ist.
Die habitualisierte Medienrezeption schließt jedoch nicht aus, dass auch die Meta-Entscheidung, regelmäßig ein bestimmtes Angebot zu nutzen (zum Beispiel eine Zeitung zu abonnieren), auf rationaler Basis erfolgt. Die Studie liefert jedenfalls genügend Anhaltspunkte dafür, dass der Leser kein irrationales Wesen ist, dessen Wünsche und Wahlen außerhalb der Reichweite wissenschaftlicher Analyse liegen und allenfalls von erfahrenen Redakteuren „erspürt“ werden können.
Trotz ihres Umfangs ist die Arbeit weder weitschweifig, noch gerät sie auf Nebengleise. Sprache und Aufbau sind präzise; Mögerle greift auf, was über das Thema geforscht worden ist, und führt es, stringent argumentierend, weiter. Wer ihr Buch gelesen hat, kann sich die Lektüre vieler anderer Werke ersparen, in denen lediglich Mutmaßungen darüber angestellt werden, was die Leser bewegt und wie die Zeitung ihre Zukunft sichern kann.
Dieser Artikel erscheint im Rahmen einer Kooperation mit dem Rezensionsportal „r:k:m“.
