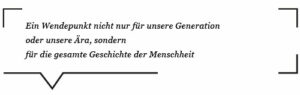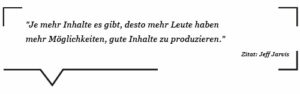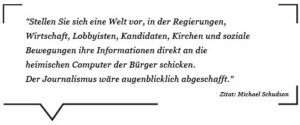Der Schwindel
Jeff Jarvis, Clay Shirky und andere prominente Medien-Erklärer in der Kritik: Dieser Essay des „Columbia Journalism Review“ über den „begrenzten Weitblick“ amerikanischer Nachrichten-Gurus löste in den USA eine Debatte über die Zukunft des Journalismus und ihre Akteure aus – VOCER veröffentlicht exklusiv die deutsche Fassung, übersetzt von Miryam Nadkarni.
„Die Frage, die die Amateurmassen den traditionellen Medien stellen, ist: Was passiert, wenn Veröffentlichungen nichts Besonderes mehr sind, weil Nutzer dies nun selber machen können? So langsam sehen wir, wie diese Frage beantwortet wird.“ – Clay Shirky
„Narrativer Journalismus dreht sich um den Schreiber und nicht die Öffentlichkeit.“ – Jeff Jarvis
„Für mich als Journalist ist es seit Langem selbstverständlich, dass meine Leser mehr wissen als ich – und das ist ein befreiendes Gefühl.“ – Dan Gillmor
„Für uns Karriere-Journalisten und Manager hat eine neue Ära begonnen, in der das, was wir wissen, und das, was wir tun, endlich seinen Marktwert gefunden hat – und der ist ungefähr gleich Null.“ – John Paton
„Es kommt alles auf die Geschichte an!“ – S. S. McClure
-EINS-
Ida M. Tarbell, eine Autorin von „McClure’s Magazine“, einer monatlich erscheinenden Zeitschrift, die sich Themen des allgemeinen Interesses widmet, plauderte mit ihrem Freund und Verleger John S. Phillips. Die beiden saßen in den Büros des Magazins in der Nähe des Madison Square Park in New York und überlegten, welchen Geschichte sie als nächstes in Angriff nehmen sollten.
Die zu diesem Zeitpunkt 43-jährige Tarbell galt bereits als eine der prominentesten Journalistinnen Amerikas. Sie hatte unter anderem erfolgreiche biographische Reihen über Napoleon und Lincoln geschrieben. „McClure’s“ hatte es teilweise Tarbells Arbeit zu verdanken, dass die Auflage auf 400.000 gestiegen und das Magazin damit zu einer der beliebtesten und profitabelsten Publikationen des Landes geworden war.
Phillips, einer der Gründer, war das Rückgrat des Magazins. Der fünffache Vater hatte den Vorsitz über ein Büro voller Bohemians und Intellektueller und war dabei so ruhig und beratend, wie der Namensvetter des Magazins, S. S. McClure, manisch und extravagant. Obwohl viele ihn für ein Genie hielten, war McClure einfach ein unerträglicher Chef: Ständig kam er aus Europa zurück und stieß die Redaktion mit neuen Projekten, Ideen und redaktionellen Änderungen ins Chaos. „Ich kann nicht still sitzen“, sagte er einst zu Lincoln Steffens. „Das ist dein Job, und ich weiß nicht, wie du das aushältst!“
„Herumgetaste“ und heiße Debatten
Bevor ein Themenvorschlag vom Magazin angenommen wurde, hatte es schon immer viel „Herumgetaste“ gegeben, wie Tarbell es später nennen sollte – und dieses Mal gab es davon mehr als gewöhnlich. Das Thema, über das heiß debattiert wurde, war kein geringeres als die großen gewerblichen Monopole, bekannt als „Kartelle“, die einst die amerikanische Wirtschaft und das politische Leben bestimmten. Es war der Sommer des Jahres 1901.
Nicht überraschend fiel die Wahl letztlich auf Öl. Tarbell war im Ölstaat Pennsylvania aufgewachsen; ihr Vater hatte eine kleine Raffinerie geleitet sowie einen Betrieb, der Ölfässer herstellte; ihr Bruder arbeitete für einen der wenigen überlebenden Konkurrenten des größten Monopol-Inhabers. Dieser wurde die „Mutter aller Kartelle“ genannt und war die Standard Oil Company von John D. Rockefeller. Sie dominierte damals 90 Prozent der gesamten Ölindustrie. Tarbell erstellte also ein Konzept, dem Phillips zustimmte. McClure, dessen Arzt ihm einen Erholungsurlaub verschrieben hatte, befand sich jedoch in der Schweiz. „Flieg rüber“, sagt Phillips, „und zeig Sam den Entwurf.“
„Darüber will ich erst einmal nachdenken“, sagte McClure, nachdem Tarbell ihm die Idee in einem Lausanner Krankenhaus vorgestellt hatte. Dann verkündete er, dass sie sich die Geschichte auch auf dem Weg nach Griechenland, wo seine Familie den Winter verbringen würde, durch den Kopf gehen lassen konnten. „Wir können Standard Oil genauso gut in Griechenland wie hier besprechen“, sagte er. So fuhren sie in Richtung Süden und legten immer wieder Zwischenstopps ein, um sich die italienische Seenlandschaft und Mailand anzugucken. Dort entspannten sie sich in der berühmten Salsomaggiore Therme und grübelten zwischen langen Schlamm- und Dampfbädern darüber nach, mit wem und was sie sich nun anlegen würden.
Schließlich wurde Tarbell ungeduldig und verkürzte ihren Abstecher, um mit der Geschichte anfangen zu können. Mit der Einwilligung in den Händen kehrte sie nach New York zurück und begann an der Reportage zu arbeiten, die bis heute als einer der besten Wirtschaftsberichte aller Zeiten gilt.
Die große wirtschaftliche Frage ihrer Zeit
Ah, die alten Medien. Gute Zeiten. Da wurde noch die Welt gerettet. Zeiten, als noch ein investigativer Journalist mit der Kühnheit, einen angemessenen Lebensunterhalt für seine Arbeit zu fordern (damals bezahlte „McClure’s“ gemessen am heutigem Dollar-Stand mehr als eine Millionen Dollar für eine Geschichte), die Vorhänge vor den mächtigsten und geheimsten Organisationen der Welt zurückziehen konnte. Gesetzesbrecher und Werteschmied zugleich.
Tarbell wird nachgesagt, Auslöser für den bedeutenden monopolfeindlichen Prozess zu sein, der 1911 schließlich den „Oktopus“ zerbrach. Ihre wahre Größe bestand aber darin, dass sie einen Berg sorgfältig recherchierter Fakten so vorstellen und erklären konnte, dass die verblüffte und beunruhigte Mittelklasse die große wirtschaftliche Frage ihrer Zeit verstand.
Ursprünglich hatte „McClure’s“ eine dreiteilige Serie geplant, doch als die Exemplare geradezu aus den Zeitungsständen flogen, wurden daraus erst sieben Teile, dann zwölf und schließlich eine nationale Sensation. Die Fortsetzungen wurden bald selber zu Nachrichtenereignissen, über die andere Zeitungen, einschließlich des frisch gestarteten „Wall Street Journal“, berichteten. „The History of the Standard Oil Company“ (Originaltitel) hatte schließlich 19 Teile und wurde zügig in ein zweiteiliges Buch verwandelt. In einer Karikatur des Satiremagazins „Puck“ wurde Tarbell als eine reitende Johanna von Orleans inmitten einer Ruhmeshalle voller Muckrakers, im Schmutz wühlender Enthüllungsjournalisten, abgebildet. Eine andere zeitgenössische Zeitschrift verkündete, dass sie die „beliebteste Frau in Amerika“ sei.
Niemandem, der das hier liest, muss ich erklären, dass wir eine neue Ära betreten haben. Uns wird gesagt, dass der Journalismus der Industriezeit gescheitert ist und falls nicht, dass er zumindest vorbei ist. Die Firmenaktien der Zeitungen werden für weniger als einen Dollar verkauft. Bedeutende Lokalredaktionen werden wie Getreide massenweise abgemäht. Wo früher gewissermaßen ein Monopol über ein ganzes großstädtisches Gebiete herrschte, gibt es nun Unterhaltungen und Gemeinschaften, dafür aber auch Chaos und Verwirrung.
Vorreiter journalistischen Denkens treten nach vorne, um Dinge zu erklären – und wir sollten dafür dankbar sein. Wenn sie das nicht tun würden, müssten wir sie erfinden. Irgendjemand muss uns dabei helfen, dies zu begreifen. Am prominentesten sind Jeff Jarvis, Clay Shirky und Jay Rosen, auf deren Ideen wir hier unser Augenmerk richten werden. Hinzu kommen Dan Gillmor, John Paton und andere. Ihre Ideen bilden gemeinsam das, was ich den „Future of News“-Konsens (FON) nenne (zu Deutsch: Zukunft der Nachrichten).
Verschwindende Grenzen zwischen Geschichtenerzähler und Zuhörer
Dieser Konsens deutet auf eine Zukunft des Netzwerk-gesteuerten Journalismus, in der Nachrichtenorganisationen eine immer unbedeutendere Rolle spielen werden. Nachrichten werden nicht mehr auf traditionelle Weise recherchiert und verteilt. Sie werden zunehmend von einem so aktiven, aufgeklärten Publikum zusammengestellt, weitergegeben und sogar gesammelt, dass das Wort „Leserschaft“ irgendwann nicht mehr zutreffen wird. Nennen wir sie doch eine Nutzerschaft oder besser noch eine Gemeinschaft.
Unsere ist eine vernetzte Welt, in der sich die Grenzen zwischen Geschichtenerzähler und Zuhörer zugunsten einer Unterhaltung zwischen Gleichgestellten auflösen. Früher war das Gespräch zwischen Berichterstatter und Leser eine hierarchische Beziehung, im Gegensatz zu, sagen wir, einer einfachen Arbeitsaufteilung.
Im Kern ist der FON-Konsens anti-institutionell. Er glaubt, dass alte Institutionen verwelken müssen, um Platz für die Netzwerk-Zukunft zu schaffen. Das Kennzeichen einer Revolution ist, dass die Ziele der Revolutionäre nicht in der institutionellen Struktur der bestehenden Gesellschaft enthalten sind. In „Here comes everybody“ schrieb Shirky 2008 seine Theorie der Popularisierung der Netzwerke. „Es wurde entweder die Revolution zerschlagen, oder einige der Institutionen verändert, ersetzt oder vernichtet.“ Falls diese Vision der Zukunft nicht mit Ihren jeweiligen Nachrichtenpräferenzen übereinstimmt, na, dann Pech gehabt, oder wie Leute auf Twitter es vielleicht sagen würden: #SOL (kurz für shit out of luck, quasi: Pech gehabt).
Das Establishment murmelt „Institutionen“
Seien wir ehrlich: In der Debatte über die Zukunft des Journalismus hat die FON-Clique die Oberhand. Das Establishment ist pessimistisch und alt; der FON-Konsens optimistisch und jung (oder behauptet zumindest, die Jugend zu repräsentieren). Das Establishment hat keinen Plan; der FON-Konsens sagt, dass kein Plan der Plan sei. Das Establishment hält langatmige Reden über Regeln und Standards; die FON-Denker sprechen von Freiheit und Formlosigkeit. FON sagt „billig“ und „frei“; das Establishment fragt nach der Kreditkartennummer. Die FON redet über „Netzwerke“, „Gemeinschaften“ und „Liebe“; das Establishment murmelt „Institutionen“, wie die „New York Times“, oder psychiatrische Anstalten.
Das Aufblühen neuer Stimmen und die Explosionen der Gespräche sind in Wirklichkeit atemberaubend, ein modernes Wunder. Nachrichtenkanäle wurden gezwungen von ihren Podesten zu steigen und das ist größtenteils eine gute Sache. Die Idee, dass Gemeinschaften über sich selber berichten und Wissen im Dienst des Journalismus ansammeln, ist durchaus attraktiv. Wenn der FON-Konsens aber Recht behält, hat die Öffentlichkeit ein Problem. Man könnte es das Ida-Tarbell- oder aber das Nick-Davies-Problem nennen.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass Berichterstattung über Themen des öffentlichen Interesses den wahren Wert des Journalismus ausmachen und den Hauptgedanken und das Prinzip des amerikanischen Journalismus darstellen. Eben diese Art der Berichterstattung ist aber normalerweise teuer, riskant, stressig und zeitaufwendig. Sie ist nicht nur ein weiterer Tab auf einer Homepage. Vielmehr hat sie einen tiefgründigen Wert, baut Vertrauen auf, legt die Tagesordnung fest, klärt die Öffentlichkeit auf, fordert mächtige Institutionen heraus und bringt Neuerungen herbei. Letztendlich ist sie der Sinn des Journalismus.
Der FON-Konsens befasst sich nicht nur sehr wenig mit dem Public-Service-Journalismus, dem journalistischen Dienst an der Öffentlichkeit, sondern ist in vielerlei Hinsicht sogar dessen Gegensatz. Zum einen würde seine Anti-Institutionalismus-Haltung den Journalismus entmachten. Insbesondere Jarvis und Shirky gefallen sich selbst in der Rolle der intellektuellen Leichenbestatter und Trauerbegleiter der Zeitungsindustrie, obwohl diese, trotz ihrer vielfältigen Schwächen, traditionellerweise immer die Bürde des Public Service getragen hat (gehen Sie auf Pulitzer.org, um sich den Haufen der Enthüllungen anzugucken von Korruption in der St. Paul Feuerwehrwache in Minnesota bis zu Verschwörungen der Tabakindustrie). Die Vision des FON-Konsens, die Zeitungsindustrie mit einer vernetzten Alternative oder etwas anderem zu ersetzen, ist jedoch noch sehr vernebelt.
Die praktischen Verordnungen der FON – die sie die Beschäftigung mit den Lesern nennen – sind inzwischen ein weiterer Vorwand für die Nachrichtenmanager geworden, die Produktionskosten zu reduzieren. Sie legen nun die wertvollste Quelle der Journalisten trocken, diese eine Sache, die ihnen Leistungsfähigkeit ermöglicht: die Zeit.
Das Risiko für den Journalismus ist groß. Vor hundert Jahren war unklar, ob ein Mann wie Rockefeller nicht mächtiger als der Präsident der Vereinigten Staaten war. Vor hundert Tagen war es ebenfalls alles andere als eindeutig, ob Rupert Murdoch oder der britische Premierminister mehr Macht haben. Heute ist dies geklärt und das größtenteils Dank des Reporters Nick Davies und seiner Redakteure vom „Guardian“, die über eine lange Zeit einsam die Verbrechen und Vertuschungen in Rupert Murdochs News Corporation untersucht haben. Während der FON-Konsens im Wesentlichen ahistorisch ist – wir befinden uns in einer Revolution und schreiben das Jahr III oder so -, wissen wir, dass Journalismus ein Kontinuum ist. Was Tarbell getan hat, was Davies und alle anderen bedeutenden Journalisten machen, geschieht immer in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft. Mit wem auch sonst?
Der News-Corp.-Fall bietet einige faszinierende Einblicke in eine alternative Nachrichtenzukunft zu der des FON-Konsens, dem die nächsten Worte gebühren.
-ZWEI-
FON-Denker sind erst vor ein paar Jahren aufgetaucht und repräsentieren eine neue Art des öffentlichen Intellekts: journalistische Hochschulen, die weder für ihre Publizistik noch ihre Forschung bekannt sind. Trotzdem füllen sie eine, von dem intellektuell erschöpften Journalismus-Establishment, zurückgelassene Lücke mit knackiger, lesbarer und voluminöser Prosa, die die Möglichkeit bietet, Journalismus und technokratische Vorreiter zu verbinden.
Jarvis ist der Autor von „What Would Google Do?“ (2009, deutscher Titel: „Was würde Google tun?“), einem Lobgesang auf die Suchmaschine, und „Public Parts“ (2011), das von den Vorteilen der Publicness – also Öffentlichkeit als Gegensatz zu Privatsphäre – handelt. Rosen ist Leiter einer Ansammlung von Hochschulabsolventen in der Journalistischen Fakultät der New York University, Blogger und Twitterer. Früher war er der Anführer einer bürgerlichen Journalismusbewegung (Stichwort Bürgerjournalismus). Obwohl es sie bereits gab, bevor das Internet seine heutige Popularität erreicht hatte, ähnelt sie den vernetzten Journalimusschulen (wie wir sehen werden, ist Rosen, der eigentlich ohne Frage Teil des FON-Konsens ist, trotzdem von einem anderen Schlag). Gillmor ist ebenfalls ein Vertreter des Journalismus, bei dem Massen als Quellen genutzt und Gemeinschaften mit einbezogen werden. Paton, Kopf der Zeitungskette Journal Register Company, ist ein FON-Befürworter, der viele Social-Media-Strategien der Denker anwendet und ihren Fachjargon übernommen hat.
Auch wenn die Macht der Medien zerstreut wurde, ist und bleibt es eine kleine Welt: Jarvis und Rosen (zusammen mit Emily Bell der Columbia Graduate School of Journalism) beratschlagen sich mit Patons Journal Register Company. Shirky schrieb die Rezension über Gillmors neues Buch. FON-Denker treten gemeinsam in Gremien auf, etc.
Berichterstattung in Phasen
Die Gemeinsamkeit ihrer Publikationen, vor allem die von Jarvis und Shirky, besteht darin, dass sie glauben, dass die Netzwerke eine umgestaltende Wirkung auf den Journalismus und sogar die Welt haben. Außerdem teilen sie ein zwar nicht identisches, aber zumindest verwandtes Vertrauen in die Weisheit der Massen und den bürgerlichen Journalismus. Sie glauben an ehrenamtliche Tätigkeiten anstelle von Berufsausübung, an „Journalismus als Gespräch“ anstelle von traditionellen Modellen, wo Einzelne viele mit Informationen versorgen. Der Konsens ist der Meinung, dass Berichterstatter und Redakteure über soziale Medien in einen tiefen und möglichst konstanten Kontakt mit den Lesern treten müssen – vor allem über Facebook und Twitter.
Der Konsens bevorzugt Journalismus in vielen kleinen Schritten – in Eile berichten und Fehler unterwegs korrigieren – gegenüber traditionellen Berichterstattungsmethoden, bei denen Fakten vor der Veröffentlichung überprüft und die Berichte redigiert werden. Er bevorzugt Spontaneität und Formlosigkeit gegenüber formellen Stilen und narrativen Formen.
Das FON-Denken hat seinen Ursprung in nicht-journalistischen Hochschulen, vor allem aber in dem Denkbild der peer production, der Teilnahme bürgerlicher Amateure an professionalisierten Aktivitäten. Basierend auf den publik gemachten Ideen des prominenten Rechtstheoretikers Yochai Benkler, des Medienwissenschaftlers Henry Jenkins und Shirkys besagt diese Theorie, dass die drastisch gesunkenen Organisations-, Kommunikations- und Verteilungskosten viele Bereiche des modernen Lebens, darunter auch ohne Frage den Journalismus, umstülpen werden. Befürworter der peer production (auch als „soziale Produktion“ bekannt) nennen erfolgreiche Open-Source-Modelle wie Linux oder Wikipedia die Vorläufer der vernetzten Zukunft.
Shirky schreibt: „Soziale Produktion: Unbekannte Menschen verbessern einem das Leben und zwar umsonst.“
Die peer production ist Teil eines größeren Gedankens bezüglich der Netzwerke und der Gesellschaft. Sie neigt dazu, fundamentale Unterschiede zwischen der verkabelten Gesellschaft und ihren Vorgängern zu sehen – weniger hierarchisch, dafür demokratischer, kollaborativer, freier und sogar authentischer. Manuell Castells, ein wichtiger Netzwerktheoretiker, behauptet, dass Technologie den „Prozess der Ausbildung und die Ausübung mächtiger Beziehungen“ verändern wird. Nicholas Negroponte, der zurzeit eine Auszeit vom Massachussets Institute of Technology nimmt, sagt, dass das Internet dabei sei, „Organisationen einzuebnen, die Gesellschaft zu globalisieren, Kontrolle zu dezentralisieren und zu helfen, Menschen zu harmonisieren“.
Symbol der persönlichen Befreiung
Einige Aspekte der Peer-production-Theorie und deren FON-Sprössling scheinen durchaus vertraut – darunter Anti-Institutionalismus, Kommunitarismus zusammengeschnürt mit Libertarismus, eine tausendjährige Wassermannzeitalter-Stimmung und ein gewisser Kampfgeist. Einige Wissenschaftler machen die Wurzeln der Peer-production-Theorie in der Gegenkultur der sechziger Jahre aus.
Der Stanforder Kommunikationstheoretiker Fred Turner warnt vor den Peer-production-Möglichkeiten. Er dokumentierte die Entwicklung eines Netzwerks von Sechziger-Jahre-Idealisten um Stewart Brand, dem visionären Gründer des „Whole Earth Catalog“, einem Kult-Handbuch aus dem Jahr 1968, und von „Wired“, der Zeitschrift des neuen Wirtschaftszeitalters, die 1993 zum ersten Mal herausgeben wurde und seitdem als digitale Bibel gilt. Diese „neuen Kommunarden“, wie Turner sie nennt, die sich aus der verteidigungsorientierten kalifornischen Recherche- und der Gegenkultur entwickelt haben, sind die Vorreiter der digitalen Revolution. Dank ihnen ist der Computer nun nicht mehr, wie ursprünglich, ein Symbol der Bürokratie und der Kontrolle, sondern der persönlichen und sozialen Befreiung.
Vorhersehbar dickköpfige alte Hasen
Man kann ohne großes Risiko behaupten, dass zwischen den Befürwortern der peer production und den professionellen Journalisten eine kulturelle Kluft existiert. Wo professionelle Journalisten vielleicht „Watergate“ denken, vermuten Anhänger der peer production eine „Prä-Irakkrieg-Berichterstattung“. Der Establishment-Journalismus erinnert sich liebevoll an elegante Berichte des „Wall Street Journal“ und bedeutende, regionale Enthüllungsgeschichten des „Philadelphia Inquirer“ und des „Miami Herald“; FON-Anhänger denken stattdessen an „die Wall-Street-Berichterstattung der Prä-Finanzkrise“ und den US-amerikanischen Medienkonzern Gannett. Hier haben sie nicht ganz Unrecht.
Befürworter der peer production mussten außerdem einigen vorhersehbar dickköpfigen, alten Hasen mit abwehrender Haltung entgegentreten – Griesgrame, „Journalimusschulen-Händeschütteler“, „Öffentliche-Gelder-Typen“ und Unternehmensführer, die den Wert der Zeitungsverlage aufgesaugt haben und sich nun darüber beschweren, dass Fremde auf ihrem Rasen herumrennen.
Shirky, ein Dozent und Referent der New York University, hat der Zeitungsindustrie zumindest ein zu begrüßendes Dringlichkeitsgefühl vermittelt. Im Wesentlichen sagt er: Wacht verdammt nochmal auf! In seinem oft zitierten Essay über das Dilemma der Zeitungen erinnert uns Shirky daran, dass in unseren revolutionsträchtigen Zeiten die Radikalen rational und die Vorsichtigen verrückt sind.
In den Zeitungen waren die Pragmatischen diejenigen, die einfach aus dem Fenster schauten und merkten, dass die reale Welt immer mehr einem undenkbaren Szenario zu ähneln begann. Man behandelte diese Leute so, also wären sie durchgeknallt. Gleichzeitig wurden diejenigen mit unrealistischen Visionen von ummauerten Gärten und der Einführung von Kleinstbeiträgen nicht als Scharlatane, sondern als Retter angesehen.
Ähnlich wie Jarvis ist Shirky einer der führenden Verfechter der Idee, dass wir uns an einem Wendepunkt befinden; nicht nur für unsere Generation oder unsere Ära, sondern für die gesamte Geschichte der Menschheit. Diese Idee beruht auf der von einem dänischen Wissenschaftler geprägten Gutenberg-Parenthese, die besagt, dass das Internet die Macht hat, das menschliche soziale Leben in einem unvorhersehbaren Maß zu prägen, genau wie Johannes Gutenbergs Druckmaschine letzten Endes den Weg für die Moderne ebnete.
Shirkys Argumenten zufolge werden unsere konventionellen Ansichten über Arbeit und Ansporn nicht bestehen können, da die Kosten für Zusammenarbeit und Verteilung so gering sind. Menschen sind schon immer aus vielen Gründen zusammengekommen. Shirky vergleicht zum Beispiel Wikipedia mit dem Shinto-Schrein im japanischen Ise, der regelmäßig abgerissen und von ansässigen Priestern wieder aufgebaut wird (wie viele Internetarbeiter wird auch ihre Arbeit von etablierten Autoritäten, in diesem Fall der Unesco, nicht gewürdigt). „Es existiert nicht als Gebäude, sondern als Akt der Liebe“, sagt Shirky. Wikipedia existiert, weil genug Menschen es lieben und, was noch wichtiger ist, weil die Menschen einander in diesem Kontext lieben.“
Auf bestimmte Art und Weise ist Shirky der subtilste und vorsichtigste der FON-Mannschaft. Viele seiner Verordnungen für die Wirtschaft des Journalismus entsprechen dem gesunden Menschenverstand und sind sogar weise. Was ich für unbestreitbar halte, ist, dass, obwohl einige Nachrichtenmodelle sich in bestimmten Kontexten bewährt haben – die Pay Wall des „Wall Street Journal“, das Spendenbeschaffungsmodell von „ProPublica“ (im Grunde ein großer Spender), das auf Werbung basierende Onlinesystem von „Talking Points Memo“ – nichts davon bis heute skalierbar ist. Es gibt überhaupt kein geschäftliches „Nachrichtenmodell“.
Wer kann sich also mit Shirky darüber streiten, dass er unentwegt fordert, zu experimentieren? „Was kann an seiner Stelle funktionieren, wenn das alte Modell zerbrochen ist?“, fragt er rhetorisch. „Die Antwort lautet: Nichts wird, aber alles könnte funktionieren. Dies ist die Zeit für Experimente, viele, viele Experimente.“
Ein bisschen Zuversicht
Falls das letzte Stück ein bisschen zu oberflächlich klingt: Ein weiterer Aspekt der FON-Debatte besagt, dass Ideen mit vollkommener Gewissheit geäußert werden, auch wenn es an Gewissheit mangelt. Shirky diskutierte über diesen Zuversichtsfaktor im Jahr 2010 in seinem Blog. Er grübelte darüber, „ob Frauen sich wie selbstverherrlichende Arschlöcher benehmen können“. Er erinnerte sich an einen Wendepunkt in seiner eigenen Jugend, als er vor einem Leiter einer Designhochschule, an der er sich beworben hatte, mit seinem Zeichentalent bluffte. „Diese Art des Benehmens meine ich. Ich saß im Büro einer Person, die ich gleichzeitig bewunderte und fürchtete, die den Schlüssel für etwas, was ich wollte, in der Hand hatte, und ich habe ihn angelogen.“
Natürlich wissen wir, was er meint, und es geht nicht ums Lügen. In FON-Debatten kann ein bisschen Zuversicht aber viel bringen.
Damit kommen wir zu Jeff Jarvis. Er ist Leiter des Tow-Night Center for Entrepreneurial Journalism der CUNY Journalismus-Hochschule und geht mit seinem guten Beispiel voran. Wie andere FON-Denker stimmt er dem Widerspruch, peer production und ehrenamtliche Tätigkeiten von einer institutionellen Sicherheit zu trennen, zu. In Jarvis‘ Fall ist dies doppelt holprig, denn: Er ist ein Gegner des durch öffentliche Gelder finanzierten Journalismus, obwohl sein journalistisches Unternehmertum durch eben diese öffentlichen Gelder subventioniert wird. Das „C“ in CUNY steht für „City“.
Das Unternehmertum manifestiert sich, ohne Frage, in seinen vielen beratenden Auftritten (The Guardian Media Group, The „New York Times“ Company), Reden (Edelman, Hearst, Hill&Knowlton) und einem Gespür für Eigenwerbung. Er ist ein Meister der Modeworte – „googlejuice“, „Generation G“ – und der Schlagworte – „die Kunden haben nun das Sagen… der Massenmarkt ist nun tot und wurde durch die Masse der Nischen ersetzt… wir haben uns von einer Mangel- in eine Überflusswirtschaft bewegt… klein ist das neue Groß“.
Jarvis stellt sich selbst als ein wandelndes Experiment der sozialen Medien dar. Es beginnt mit umfangreichen und profanen Tweets („Das Arschloch hinter mir im Zug benutzt ihr Handy als Lautsprecher. Eine neue Grenze der Zug-Handy-Unhöflichkeit“ [9. Juni 2011]; „Hey T-mobile, fick dich mit deinen Höflichkeitsanrufen. Gib mit Höflichkeitsservice“ [19. Februar]; oder öffentliche Updates darüber, wie seine Prostatakrebsbehandlung verläuft). Jarvis verursachte eine Menge Klatsch und Tratsch, als er während der diesjährigen Kreditgrenzen-Debatte eine Twitter Protestkampagne unter dem Hashtag #fuckyouwashington startete.
Sein „What would Google Do?“ ist nahezu eine Karikatur der Netzwerktheorie, die der Suchmaschine und der Internetkultur zujubelt, da diese neue Kapitalismus- und Gesellschaftsformen hervorbrächten (die Betonungen stammen von mir):
»Wir brauchen keine Unternehmen, Institutionen oder Regierungen mehr, die uns organisieren. Wir haben nun die Mittel, um uns selber zu organisieren. Wir können uns gegenseitig finden und durch politische Angelegenheiten, schlechte Unternehmen, Talent, Geschäftliches oder Ideen zusammenwachsen. Wir können unser Wissen und Benehmen mitteilen und einordnen. Wir können im Nu zusammenkommen und kommunizieren. Außerdem haben wir eine neue Ethik und neue Einstellungen, die dieser neuen Organisation entspringen und die Gesellschaft in unvorhersehbaren Maßen verändern werden: mit Offenheit, Großzügigkeit, Zusammenarbeit und Effizienz. Wir nutzen das verbindende Gewebe des Internets, um über Grenzen zu springen – ob sie nun Länder oder Unternehmen oder Demografien umgeben. Das ist die neue Weltordnung von Google – und Facebook und Craigslist.«
Diese Redekunst zeigt uns, dass die Zukunft der Nachrichten durch Unsicherheit definiert ist und sich nicht für empirische Untersuchungen eignet. Journalisten mögen Fakten und Daten. Hier gibt es keine. Wir befinden uns im Reich des Glaubens.
Auch wenn ein Großteil seiner journalistischen Ratschläge weniger messianisch und häufig auch vernünftig ist („Cover what you do best. Link to the rest.“ etc.), befürwortet er noch viel stärker als Shirky, dass das Alte dem Neuen weichen muss. Was genau dieses Neue ist, ist noch nicht klar, aber es wird Technologie, Netzwerke, Unternehmertum, iterativen Journalismus, Gespräche zwischen den Nutzern und neue Arten der Informationsverbreitung beinhalten. „Digital first“, ein Ausdruck der sich nach und nach im Journalismus einbürgert, ist eine radikale Revision der normalen Tätigkeiten der Nachrichtenorganisationen (die Betonungen stammen von mir):
»“Digital first“ verändert die journalistische Beziehung mit der Gemeinschaft, sodass die Nachrichtenorganisationen, weniger der Produzent, eine offene Plattform ist, auf der die Öffentlichkeit alles, was sie weiß, mitteilen kann. Die Journalistin kann diesem Prozess einen Wert hinzufügen. Sie darf dies in verschiedenen Formen tun – berichten, sich um Leute und ihre Informationen kümmern, Anwendungen und Werkzeuge bereitstellen, Daten sammeln, organisatorischen Aufwand betreiben, Teilnehmer ausbilden… und Artikel schreiben.«
Die Gewichtung verschiebt sich vom Faktensammeln und Berichten auf andere Dinge wie Vermitteln, Vereinfachen, Beraten. Im Jahr 2009 schrieb Jarvis einen Blogbeitrag, von dem er sagt, dass er ihn gerne als Rede vor einer Versammlung von Nachrichten-Geschäftsführern gehalten hätte:
»Ihr habt es vermasselt… Jetzt haben viele von euch keine Zeit mehr. Es ist einfach zu spät. Das beste, was einige von euch machen können, ist den Platz für die nächste Generation der Netz-Einheimischen zu räumen. Sie werden das, was nach euch kommt, von Grund auf errichten, weil sie die neue Wirtschaft und Gesellschaft verstehen und die Nachrichten ernst nehmen und diese neu erfinden werden. Darin liegt für sie eine große Chance.«
Ältere Eliten müssen also Platz für neue Leute machen – zumindest für „die nächste Generation der Netz-Einheimischen“. Das „wir“ und die „Leute“, von denen Jarvis spricht, seid bestimmt nicht „ihr“. Folgendes schrieb er mit dem Hauch einer Drohung in „What would Google do?“: „Menschen können einander überall finden und sich mit dir verbinden – oder gegen dich.“
-DREI-
Es ist gut, in welch hohem Maß die FON-Denker das Nachrichten-Geschäft kritisieren. Ihr Problem besteht darin, dass sie (Rosen ausgenommen, wie wir später sehen werden) manchmal den Journalismus, nämlich das, was Journalisten tun, aus dem Blick verlieren.
Gillmors unterwürfiger Slogan „Die Leser wissen mehr als ich“ ist auf einer gewissen, abstrakten Ebene wahr, bei wichtigen Angelegenheiten trifft er aber meistens ganz einfach nicht zu. Obwohl viele ihrer Quellen plötzlich auftauchten, um ihr zu helfen, wussten weder einzelne Leser noch Lesergemeinschaften jemals mehr über Standard Oil als Ida Tarbell. Genauso wenig konnte man erwarten, dass Leser die Reichweite und Folgen der Geschichte von „News of the World“ kennen konnten. Nick Davies ist kein Genie, aber er hatte immerhin jahrelang an diesem Bericht gearbeitet. Nachdem er drei Jahrzehnte in diesem Geschäft tätig war, hatte er – ich traue mich kaum, es auszusprechen – nicht nur viele Quellen, sondern auch professionelle Fähigkeiten und andere Qualitäten erworben, die einige Leser, sogar Akademiker, nicht besitzen.
Es geht aber noch weiter.
FON-Denker schlagen vor, dass es sich bei Nachrichten um Allerweltsprodukte handelt, die teilweise zu üppig, undifferenziert und von geringem Wertsind. Infolgedessen geht das FON-Denken davon aus, dass mit Nachrichten kaum Geld einzunehmen ist, da ihre Verteilungskosten fast gleich Null sind.
Nachrichten sind Allerweltsprodukte
Wenn sich das Argument darauf beschränken würde, dass die Kosten, um Nachrichten zu kopieren, inzwischen gleich Null sind, wäre das eine Sache. FON-Denker gehen aber einen Schritt weiter. Sie behaupten, dass Nachrichten (im Gegensatz zu, sagen wir mal, über Nachrichten zu schreiben) von Natur aus Allerweltsprodukte sind.
Shirky schrieb (meine Betonung):
»Eine Möglichkeit dem Konsumwarenmarkt zu entgehen, besteht darin, etwas anzubieten, was kein Allerweltsprodukt ist. Dies ist der bevorzugte Rat der Menschen, die sich für die Wiederbelebung der Zeitungen einsetzen. Eine derart platte Floskel, dass sie einem Trinkspiel entsprungen sein könnte und die jeder Berater den Zeitungen irgendwann sagen wird, ist: „Ihr müsst lediglich ein so relevantes und wertvolles Produkt anbieten, dass der Konsument bereit ist, dafür zu bezahlen.“
Dieser Rat ist gut gemeint, aber keine große Hilfe. Der Vorschlag, dass Zeitungen in Zukunft digitale Produkte, die die Nutzer auch bezahlen würden, herstellen sollen, ist lediglich eine Umformulierung des Problems und ein Eingeständnis, dass die derzeitigen Produkte diesen Anspruch nicht erfüllen.
Paywalls haben dies nicht geschafft. Sie haben keine weiteren Einnahmen durch das bestehende Publikum, weil sie ihr Publikum auf eine zahlungswillige Untergruppe schrumpfen. Paywalls verhindern tatsächlich, dass Zeitungen dem Prozess der Kommerzialisierung verfallen, aber nur, weil sie die Leser, die Nachrichten als Allerweltsprodukt sehen, abstoßen – und das sind alle, mit wenigen Ausnahmen.«
Lassen wir mal die Tatsache beiseite, dass die Kundschaft eines Unternehmens durch „eine zahlungswillige Untergruppe“ definiert ist. Beachten Sie, dass Shirky die Tatsache, dass Zeitungen kein Geld für Nachrichten verlangt haben (ich frage mich, wer ihnen bloß diesen Rat gegeben hat) darauf zurückführt, dass der Markt bestimmt habe, dass sie kein Geld verlangen können. Auch Jarvis spricht von einer undifferenzierten, üppigen Medienlandschaft:
»Gibt es in den Medien überhaupt noch irgendeine Seltenheit? Manche sagen, dass Vertrauen selten sei. Na ja, ich denke, dass das wohl immer wahr gewesen ist, aber jetzt habe ich mehr Nachrichtenquellen als je zuvor – nicht nur meine Lokalzeitung, sondern auch „Washington Post“, „Guardian“ und BBC, Blogger, die ich respektiere, und weitere. Ist Qualität also immer noch selten? Ja, natürlich, aber je mehr Inhalte es gibt, desto mehr Leute haben mehr Möglichkeiten, gute Inhalte zu produzieren.«
Sollte Jarvis nicht zufällig im Londoner Westminster leben, stehen die Chancen sehr schlecht, dass die BBC über seinen Wohnort berichtet. Und erhöhen mehr Inhalte tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand über beispielsweise die Pawtucket City Hall berichtet? Aus Liebe vielleicht?
Ich habe über die Pawtucket Hall berichtet, und man musste mich dafür bezahlen.
Nachrichten als ein nahezu wertloses Alllerweltsprodukt (oben sagt Paton, dass ihr Wert ungefähr gleich Null sei) zu betrachten, ist ein fundamentaler und entlarvender Denkfehler. Ein Allerweltsprodukt ist in Anniston, Alabama, Pawtucket und Rhode Island gleich. Was auch immer Sie unter Lokalnachrichten verstehen, das sicherlich nicht.
Eine Generation, die es einfach nicht kapiert
Infolgedessen haben FON-Denker abonnierbare Paywalls als altes Gedankengut einer Generation, die es einfach nicht kapiert, verhöhnt. Insbesondere Shirky und Jarvis haben zunächst die frühzeitig erfolgreiche Paywall des „Wall Street Journal“ abgelehnt, dann die ebenfalls erfolgreiche Paywall der „Financial Times“ (aus irgendeinem Grund sind Finanznachrichten keine Allerweltsprodukte, sondern Magie) und andere punktuelle Erfolge lautstark als Anomalien verworfen. Sie haben auch ohne zu zögern auf den Zusammenbruch von TimesSelect, einem frühen Experiment der „New York Times“ im Jahr 2005, hingewiesen.
Jarvis war sich sogar noch viel sicherer. „Die ‚Times‘ hat den Service 2007 abgeschafft und die Inhalte aus einigen Gründen frei zugänglich gemacht: Erstens hat sich dadurch das Publikum auf der Webseite der Zeitung vergrößert. Zweitens konnte die ‚Times‘ durch die Werbung, die dem digitalen Publikum gezeigt wird, mehr Geld einnehmen. Drittens…“ Und so weiter.
Aber schauen Sie mal: Die neue Paywall der „Times“, ein gebührenpflichtiges System, bei dem die Nutzer einige Seiten kostenlos lesen können, für unbegrenzte Einsicht aber bezahlen müssen, funktioniert. Nach gerade mal vier Monaten bezahlten bereits viel mehr Nutzer als vorhergesagt, nämlich 224.000, Geld, um die Website zu lesen. „Advertising Age“ zufolge hatte die Zeitung, zusammen mit den 57.000 Kindle- und Nook-Abonnenten und den rund 100.000 Nutzern, deren digitaler Zugriff von der Lincoln-Abteilung von Ford gesponsert wurde, fast 400.000 bezahlende Online-Nutzer (und rund 765.000 weitere Print-Abonnenten registrierten ihre Accounts im Internet).
Obwohl einst behauptet wurde, dass lediglich die hochwertigsten Finanz-Zeitungen die Erlaubnis haben würden, für ihren Onlineauftritt Geld von den Nutzern zu verlangen, hat sich der Trend inzwischen in die andere Richtung entwickelt, da immer mehr Zeitungen ein Bezahlsystem eingeführt haben. Sogar das schäbige Lee Enterprises, eine Zeitungskette, die ihren Sitz in Davenport, Iowa hat, kündigte an, von nun an kleine Summen – 1 bis 2,95 Dollar im Monat – für den Gebrauch ihrer Wyominger und Montana Zeitungswebsites zu erheben. Der „Poynter“-Wirtschaftsblogger Rick Edmonds nennt die wichtigen Akteure, die noch kein Bezahlsystem eingeführt haben – Gannett, McClatchy und die Washington Post Company – „Verweigerer“.
Allgemeiner Zerfall des nachrichtlichen Wirtschaftsmodells
Ist die Paywall ein Wundermittel? Nein, da hat Shirky Recht. Es gibt keines. Lee bietet seine Ware für unter einen Dollar an. Wie viele, inklusive Shirky, jedoch bereits betont haben, sind Nachrichten keine Allerweltsprodukte, sondern „öffentliches Gut“ – etwas, von dem alle profitieren und das, im ökonomischen Sinn, seinen Wert nicht verliert, unabhängig davon, wie viele Menschen es nutzen (ob sie dafür bezahlen oder nicht). Nachrichten als im Überfluss vorhandene Allerweltsprodukte zu verleumden, macht es leichter, sie zu verschenken. Außerdem deutet es darauf hin, dass es an Verständnis darüber mangelt, was man braucht, um überzeugende Berichte hervorzubringen, geschweige denn verantwortungsvollen Journalismus.
Dass das Nachrichten-als-billige-Allerweltsprodukte-Argument eigentlich ein ideologisches, mit wirtschaftlichen Begriffen formuliertes Argument ist, wird nun erkennbar. Die Idee, dass „Information frei sein will“ (ein Teil-Zitat von Stewart Barnd, der den Wert der Information sehr wohl verstand) war ein Katechismus, ein gesammelter Schrei eines Teils der digitalen Vorreiter. Abonnements, „Walls“, passen nicht in die vernetzte Vision. Übrigens konnte die Allerweltsprodukt-Idee nur wegen des allgemeinen Zerfalls des nachrichtlichen Wirtschaftsmodells der Werbung Fuß fassen – einem Zerfall, der nichts mit redaktionellen Modellen zu tun hatte.
Das heißt nicht, dass der Inhalt gut oder nicht gut war, sondern dass das zerfallende Werbemodell nichts damit zu tun hatte. Die Nachrichten als Allerweltsprodukte zu betrachten, führte dazu, dass dies eine selbst-erfüllende Prophezeiung wurde. Wenn du es für etwas hältst, wird es das sicherlich auch werden. Vielleicht ist es in Ordnung, wenn Akademiker diese These verkaufen, aber die journalistischen Führungskräfte, die sie kaufen, sollten sich schämen.
Schwere Geschütze, dann zurückrudern
In seine Rolle als Provokateur greift Jarvis auch die Idee des Storytelling an. In einem Video-Talk auf der #140 New-Media Konferenz schlüpfte er in die Rolle eines professionellen Berichterstatters, der als arroganter Arsch die Idee der Geschichte verteidigte, um seinen Job zu retten (seine Betonungen):
»Als Berichterstatter ist es mein Job, dir die Geschichte zu erzählen, kapiert? Das heißt, dass ich entscheide, worum es in dem Bericht geht. Ich entscheide, was rein kommt. Ich entscheide, was nicht reinkommt. Ich entscheide, wie es anfängt und wie es endet, weil ein Bericht einen Anfang und ein Ende braucht, damit er in das Loch passt, in das ich es stopfen werde. Wenn du die Form der Geschichte hinterfragst, ist das ein Versuch, mir meinen Job wegzunehmen.«
Als Teil seines Handwerks fährt Jarvis gerne schwere Geschütze auf, um nachher zu behaupten, dass die Kritiker ihn falsch charakterisiert hätten, weil sie, wie gewöhnlich, nach seiner gebührenden Provokation ein bisschen wütend würden. Nachdem ein laut-gedachter Beitrag mit dem Titel „Der Artikel als Luxus- oder Nebenprodukt“ kritisiert wurden war, protestierte er anschließend in einem anderen Text:
»Zunächst will ich klarstellen, dass ich den Artikel nicht verunglimpfen, sondern hervorheben möchte. Wenn ich sage, dass ein Artikel ein Luxusgut ist, argumentiere ich, dass die mehr denn je wertvollen Produktionsmittel, die wir benutzen, um einen Artikel zu schreiben, ernst genommen werden und dass wir, bevor ein Bericht geschrieben und redigiert wird, sicherstellen sollten, dass er etwas Wertvolles beisteuern wird. Machen das die meisten Artikel heutzutage? Nein.«
Aber warten Sie! Jarvis sagt, dass Nachrichten im Überschuss vorhanden seien, er verunglimpft professionelle Journalisten als Schmierfinken und nennt die Berichterstattung eine Heuchelei, schlimmer noch, eine Unterdrückungsform. Er setzt Nachrichtenorganisationen zu bescheidenen Verwaltern für Menschen wie ihn selbst herab, wenn sie nicht eh vollends weggefegt werden. Und dann sagt er uns, dass er der größte Freund des Artikels sei.
Glauben Sie das nicht.
Zufälligerweise gibt es den Widerstand gegen „Artikel“ und „Berichterstattung“ in der Journalismusdebatte schon seit Langem von Seiten der Erbsenzähler, Nachrichten-Bürokraten und Schmierfinken. Rupert Murdoch hat narrativen Journalismus schon vor langer Zeit als Heuchelei verspottet. Er sagt, dass hier Journalisten für andere Journalisten schrieben und dass, seinem Biografen Michael Wolff zufolge, die Idee hinter dem Journalismus eine „höhere Berufung der blabla Verantwortung, des ehrfurchtsvollen Schwachsinn“ sei. Seine Übernahme des Verlags des „Wall Street Journal“ führte dazu, dass der Redaktionstisch und der Betrieb der Seite-1-Berichterstattung aufgelöst und die Nachrichtenproduktion erhöht wurde – ein Sieg einzig und allein für den iterativen Journalismus, also das erwähnte Schrittweise-Vorgehen bei Veröffentlichungen.
Rupert Murdoch weiß aber, was er tut. Journalisten von Tarbell bis hin zu denen, die für Murdochs Zeitung arbeiten, haben gezeigt, dass narrativer Journalismus die rebellischste Form des Journalismus ist. Im Jahr 2000 erzählte eine der verheerendsten Titelgeschichten auf der ersten Seite des „Wall Street Journal“ die Geschichte, wie eine Wendi Deng aus dem Nichts auftauchte und langsam eine einflussreiche Position bei News Corp. einnahm. Sie ist Murdochs Frau. Jetzt gehören Titelgeschichten zu den gefährdeten Arten im „Wall Street Journal“. War ja klar.
-VIER-
FON-Denker bekennen sich ohne Frage zur Berichterstattung über Themen des öffentlichen Interesses, dem Sahnehäubchen der Journalimusdebatten. Shirky hat des Öfteren die weltbewegende Arbeit des „Boston Globe“, die sich mit den sexuellen Übergriffen und Vertuschungen der katholischen Kirche befasst, zitiert, um daran zu erinnern, was auf dem Spiel steht. Er behauptet, dass die Debatte zwischen denjenigen gehalten wird, die glauben, dass alle Mittel in die Unterstützung der bestehenden Institutionen gesteckt werden sollten, und denjenigen, die wie er der Meinung sind, dass…
»…die derzeitige Erschütterung in der Medienwelt für das Nachrichtenproduktions-Modell des 20. Jahrhunderts so gefährlich ist, dass es eine Zeitverschwendung wäre, zu versuchen, die Zeitungen zu ersetzen. Stattdessen sollten wir uns lieber auf die Produktion vieler kleiner, überlappender Modelle des verantwortungsvollen Journalismus konzentrieren, weil wir wissen, dass wir zunächst eh keine gute Lösung finden werden und nicht wissen, welche der Experimente sich bezahlt machen.«
Obwohl Shirky und andere FON-Denker sagen, dass die derzeitigen Strukturen und Institutionen zwangsläufig aufgelöst werden müssen, würde ich gerne anmerken, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem die Vorhersage vom Zerfall der Institutionen langsam zu einer Begünstigung und schließlich zu einer Beschleunigung desselben wird. Das hat die Anti-Paywall-Debatte bereits gezeigt. Shirky würde vielleicht sagen, dass es zwar gut gemeint, aber wenig hilfreich ist, sich für die Experimente einzusetzen. Wenn es in dieser Angelegenheit tatsächlich um den Public-Interest-Journalismus geht, sollte die einzig zu stellende Frage sein, was hier helfen und was nicht helfen könnte – und zwar jetzt und nicht in 500 Jahren.
„Die neue Medienlandschaft muss chaotisch sein“, um das Experimentieren zu erleichtern, schreibt Shirky. Eigentlich „muss“ sie aber nur für die Berater und nicht für die Öffentlichkeit chaotisch sein. Wer vertritt denn eigentlich die Öffentlichkeit? Jarvis, Shirky und Co. sagen, dass sie es tun. Nicholas Carr, ein Skeptiker des Internets, und andere haben jedoch bemerkt, dass die FON-Vision ihren Schöpfern und deren Gefolgsleuten sehr ähnelt: nicht nur online, sondern total eingestöpselt; die die Nachrichten mit einer Besessenheit verfolgen, die den Redakteur stolz machen würde; Jobs haben, die ein medienzentriertes Arbeits- und Privatleben nicht nur akzeptieren, sondern sogar unterstützen würden. Niemand sollte sich Illusionen darüber machen, dass die Plätze der gefallenen Eliten nicht durch neue ersetzt werden.
In diesem Sinn wage ich jetzt einen Sprung und sage vorher, dass die Zukunft der Nachrichten der Gegenwart noch nervenaufreibend lange ähneln wird: humpelnde Nachrichtenorganisationen, die von einem Schwarm neuer Medien ergänzt werden. Es ist nicht sexy, aber so sieht es im Journalismus nun mal aus.
Ich würde sogar soweit gehen, für unumstößlich zu erklären, dass der Journalismus seine eigenen Institutionen braucht, weil er über viel größere Institutionen berichtet. Die „New York Times“ und Gretchen Morgenson, gefolgt von dem verstorbenen Mark Pittman von Bloomberg, entdeckten als erste die Wahrheit über den Notverkauf der American International Group: nämlich, dass es um die Wall Street, geführt von Goldman Sachs, ging. Diese Kämpfe wurden mit aller Macht geführt und waren hochgradig ungerecht – Goldmans Börsenkapital war ungefähr 50-mal so groß wie das der Muttergesellschaft der „Times“.
Ob es sich nun um die „New York Times“ oder den „Digital Beagle“ handelt: Wir benötigen Organisationen mit Talent, Traditionen, Kultur, Bürokraten, Genies, Monomanen, Anwälten, Gesundheitsplänen, Marketingabteilungen und Verkaufspersonal – und sie müssen es mit Institutionen wie Goldman Sachs, dem Weißen Haus und lokalen Politikern aufnehmen können. Die Öffentlichkeit braucht sie und wird sie auch haben.
Michael Schudson schrieb weise im Jahr 1995: „Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Regierungen, Wirtschaft, Lobbyisten, Kandidaten, Kirchen und soziale Bewegungen ihre Informationen direkt an die heimischen Computer der Bürger schicken. Der Journalismus wäre augenblicklich abgeschafft.“ Nach anfänglicher Euphorie, Verwirrung und Machtwechsel würde eine glaubhafte Person die Nachrichten durchgehen und in eine verständliche Form bringen müssen: „Journalismus würde in irgendeiner Form neu erfunden werden. Ein professioneller Pressekorps würde wieder auftauchen…“
-FÜNF-
Es lohnt sich, im Gedächtnis zu behalten, dass die triumphalsten FON-Arbeiten in den Jahren 2008 und 2009, der größten Panikzeit des Journalismus, geschrieben wurden. Jetzt sind diese Zeiten aber vorbei. Dieser nicht-apokalyptische Zeitpunkt macht Rosen zu einem interessanten Denker. Vermutlich gibt es keine Person, die leidenschaftlicher an das Potenzial des die Gemeinschaft einbeziehenden Journalismus glaubt als Rosen. Er ist der langjährige Leiter der öffentlichen Journalismus-Bewegung, die sich seit langem eine intimere, durchlässigere und, aus Rosens Sicht, ebenbürtige Beziehung zwischen dem Journalismus und der Öffentlichkeit ausmalt. In seinem „What Are Journalists For?“ (1999) untersuchte er die gut gemeinten und in vielerlei Hinsicht erfolgreichen öffentlichen Journalismusexperimente der mittleren neunziger Jahre, in denen Zeitungen aktiv versuchten, lokale Probleme zu lösen (nachdem zum Beispiel eine große Verteidigungsfabrikanlage geschlossen wurde, leitet die „Dayton Daily News“ 1994 die Suche nach einer Lösung für deren Wiederaufbau).
Gleichermaßen kritisieren wenige Akademiker die populären Medien und ihre unzähligen, blühenden Misserfolge auf eine zerstörerischere und bissigere Art als Rosen. In seinen Texten hat er die amerikanische Pressekultur mit einer bürokratischen Kirche verglichen, die Verharmlosung mit Wahrheitsfindung gleichsetzt und sich in Plattitüden flüchtet („Wenn uns beide Seiten kritisieren, werden wir wohl recht haben“).
Er hat die „Suche nach Unschuld“ der Presse herausgefordert. Dies bezeichnet die Idee, dass die Presse lediglich über Fakten berichtet, keinen Anteil daran hat, keine Urteile fällen muss und für keine Ergebnisse verantwortlich gemacht werden kann. Rosen hat untersucht, wie die regulären Nachrichtenkulturen, Ideen, die sich außerhalb gewisser intellektueller Grenzen befinden, ausgrenzen, weil die Redaktionen so harte Themen vermeiden können.
Journalist ist, wer die Arbeit macht
Während Schmierfinken und Fachidioten sich darüber streiten, wer „Journalist“ genannt werden darf, sagt Rosen völlig zu Recht: diejenigen, die die Arbeit machen. „Im Journalismus muss man berichten, um Autorität zu bekommen. Das richtige Know-how haben, die Fakten kennen, unter der Oberfläche nach Indizien suchen, sich umhören, um herauszufinden, was passiert ist, das Gehörte überprüfen. ‚Ich bin da, du nicht, lass mich dir davon erzählen‘.“
Das Gute an Rosens Kritik ist, dass sie Nachrichtenagenturen nicht einfach verwirft oder Krokodilstränen wegen ihres unvermeidbaren aber ach-so-bedauerlichen Niedergangs weint, sondern sie in die Debatte verwickelt und ihnen einen Anstoß verpasst, sich zu bessern.
Man muss Rosen anrechnen, dass er auch seine eigene Bewegung schon in Frage gestellt hat. Vor einer Blogger-Konferenz im Jahr 2006 schrieb er in einem Blogbeitrag, dass dies ein „Akzeptieren-oder-Klappe-halten“-Moment für die Nutzer-wissen-mehr-als-wir-These sei. Er schrieb, dass die Idee zwar wünschenswert (allgemeines Einverständnis) und möglich (oder warum, schreibt er, „hat uns Gott sonst das Internet gegeben“) sei: „Aber wie? Wie genau?“
Wahrscheinlich hatte er Unrecht damit, dass 2006 ein „akzeptieren-oder-Klappe-halten“-Moment war (immerhin denken Peer-production-Verfechter in 500-Jahre-Einheiten). Fünf Jahre später ist das „wie“ aber immer noch nicht geklärt. An der FON-Literatur ist aufschlussreich, dass die gleichen anekdotischen FON-Erfolgsgeschichten – die Berichterstattung über amerikanische Anwälte von „Talking Point Memo“, „macaca“, „bittergate“ – immer wieder auftauchen. Obwohl Shirky behauptet, dass „nichts funktionieren wird“, ist es eigentlich die peer production, die nicht Nachrichten-kompatibel ist, während Institutionen es immer noch sind.
Was nicht hieße, dass die FON-Debatte nicht wichtige Diskussionen ausgelöst hätte darüber, welche Umgebungen für den Journalismus am besten geeignet sind. Zu Recht sagen Nachrichtenprofis, dass die Institutionen den Journalisten nicht nur Mittel und Sicherheit bieten, sondern dass die besten unter ihnen wertvolle Nachrichtenkulturen schaffen, indem sie Menschen einer gewissen Einstellung verbinden. Sagen wir es mal so: Viele Menschen sind klug und skeptisch, nicht alle wollen aber ihr Leben damit verbringen, Bestechungen der öffentlichen Einrichtungsbehörde aufzudecken. Andererseits haben Peer-production-Verfechter nicht ganz Unrecht, wenn sie sich fragen, ob Nachrichtenbürokratien den Journalismus nicht genauso viel ersticken wie sie ihn fördern. Es stellt sich dann die Frage, was sie ersetzten könnte.
Leider sieht Rosen, ähnlich wie die FON-Denker, schneller die Vorteile der zerstörenden Technik als die Probleme, die sie für den Journalismus verursacht. Im August brachte er in einem Interview mit „TwistImage“, einem Blog, der von Mitchel Joel, einem Manager des digitalen Markts, geleitet wird („Seine stets verbundene Welt liefert ständig Provokationen und Einblicke in digitales Marketing und Medien-Hacking“), das wahre und häufig wiederholte Argument hervor, dass alter Journalismus der Gefangene seiner eigenen Produktionsanforderungen, des Presseablaufs, der Lieferwagen etc. sei.
»Die Sache mit den Journalisten ist, dass sie jeden Tag produzieren und die Welt alle 24 Stunden erneut abbilden müssen. So wurde die Produktionsroutine ihr Gott. Vor den Zeiten des Web waren Journalisten darauf spezialisiert, die Welt und was sie an dem Tag gelernt hatten, in sehr enge, von der Produktionsroutine zur Verfügung gestellte Nischen zu packen.«
Ironischerweise ist der Journalismus – zum Teil dank der FON-Denker und bedauerlicherweise auch Rosen – im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts Sklave eines neuen Produktionssystems geworden. Es kann nun zu jeder Zeit und unbegrenzt veröffentlicht werden, für immer und ewig. Amen.
Weil der Markt und die Welt nun mal so sind, wie sie sind, ist das Mögliche nun zum Gebot geworden. Im Gegensatz zum erbarmungslosen Ares der Web-Produktionsroutine sieht der „Gott“ des alten 24-Stunden Nachrichtenzyklus nun wie die liebliche Aphrodite aus. Und glauben Sie mir: Die neue Versklavung tut den Lesern viel mehr weh als den Journalisten, die Tag und Nacht bloggen, tweeten, podcasten, kommentieren und Schlagwortwolken erstellen müssen. Meiner Meinung nach ist das der Grund, weshalb der Journalismus heutzutage so gelungene Nachrichten, die schrittweise geschrieben und aktualisiert werden, produzieren kann, aber weniger gut darin ist, einen Schritt zurückzutreten und sich einer Geschichte wirklich anzunehmen. In manchen Kreisen wird dies missbilligt.
Die grausame Realität der aufkommenden vernetzten Nachrichtenwelt ist, dass Journalisten entmachtet werden und dass sie häufiger unter größerem Druck, weniger autonom, über trivialere Themen, schreiben müssen als in vorherigen marktbeherrschenden Systemen. Würde man tatsächlich nach Wegen suchen, die die Arbeit der Journalisten untergraben könnten, wären die FON-Ideen gute Ausgangspunkte:
- Erinnern Sie Journalisten so oft wie möglich daran, dass ihre Arbeiten nichts Besonderes und Allerweltsprodukte sind.
- Verlangen Sie von ihnen, dass sie einen Teil ihres Arbeitstages für Vermarktung, der Gestaltung ihres Markenzeichens und der Entwicklung eines Geschäftsmodels opfern.
- Bestehen Sie darauf, dass sie, anstatt zu berichten und zu schreiben, stets über Facebook und Twitter mit Ihnen in Kontakt stehen.
- Vergraben oder verwüsten Sie Nachrichteninstitutionen vorzeitig.
- Fördern sie den ungewissen Glauben an die Ehrenamtlichkeit.
- Beschreiben Sie narrative Berichte als Heuchelei oder sogar als eine Art der Unterdrückung; so wird niemand jemals Zeit haben, sorgfältig recherchierte Beweise aufzuführen. Das ist auch super für Gauner.
Ender der Neunziger schrieb ich in „The Hamster Wheel“ („Columbia Journalism Review“, September/Oktober 2010), dass die etwas über 300 Redaktionsmitglieder des „Wall Street Journal“ etwa22.000 Berichte jährlich und dazu zwei lange narrative Berichte täglich schreiben. Im Jahr 2008 produzierte weniger Angestellte fast das Doppelte. Egal, was sie sonst erreicht haben: Peer-production-Denker konnten die physikalischen Gesetze des Journalismus nicht brechen: Um ihre Arbeit ordentlich machen zu können, brauchen Journalisten Zeit und ihren Verstand.
Jetzt, wo wir nicht mehr in Panik verfallen, ist es an der Zeit, dass die Denker des Journalismus sich ihrer eigentlichen Aufgabe zuwenden: Wie geben wir den Journalisten, die nun mal das Rückgrat des Journalismus bilden, ihre Macht zurück? Und zwar egal wer sie sind und wo und für welches Medium sie arbeiten.
Mein Modell würde sich am „Guardian“ und dem Fall News Corp. orientieren und wäre Institution-zentriert, würde aber von den Netzwerken angetrieben. Das bedeutet, dass traditionelle, investigative Berichterstatter die Geschichte recherchieren und schreiben und die sozialen Medien sie in die Stratosphäre – höher als die Zeitungen es jemals alleine geschafft hätten – schießen würden. Mehr als 150.000 Menschen nutzten zum Beispiel die sozialen Medien, um erfolgreich Widerstand gegen die News-Corp.-Übernahme von bSkyb zu leisten. Ich weiß nicht, wie wir den finanziell bedrohten „Guardian“ sichern können, aber wir sollten uns einig sein, dass er gesichert werden muss (vielleicht sollte er sich eine Scheibe der „Times“-Strategie abschneiden, anstatt, wie angekündigt, „digital first“ zu gehen). Da Modewörter die Währung im FON-Reich sind, nenne ich es das neo-institutionelle Hub-and-Spoke-Modell.
Ein fundamentaler Grundsatz meiner Neo-Institutionen-Lehre ist, dass es nicht um die Institutionen, sondern um den von ihnen produzierten Journalismus geht. Für die Peer-production-Theoretiker und ihre Netzwerke gilt das meiner Meinung nach nicht.
Es ist möglich, die Institutionen wieder aufzubauen und zu stützen, dafür müssen wir aber ganz neu denken. Um es in den Worten des ursprünglichen Mediengurus, Marshall McLuhan, zu sagen: „Es gibt überhaupt keine Unvermeidbarkeiten, solange der Wille besteht, sich über das, was gerade passiert, Gedanken zu machen.“
|
Leseempfehlungen – Reaktionen auf „The Confidence Game“: Dean Starkmans Reaktion auf Bell: „It’s About the Stories“ Clay Shirky: „Institutions, Confidence, and the News Crisis“ Dean Starkmans Reaktionauf Shirky: „The Hole in FON Theory“ John McQuaid: „Dangers Lurking for the Future of News“ |
Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, Ida M. Tarbell habe Sketche über Napoleon geschrieben. Das war eine falsche Übersetzung, die wir zu entschuldigen bitte.