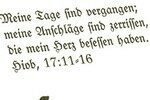
Journalisten müssen Täter sein
Wer über die Zukunft des Journalismus nachdenken will, muss zuallererst den Blick auf die Gegenwart fixieren. Ich hatte dazu ausgiebig Gelegenheit, denn der Zufall wollte, dass ich in die Jury des 2009 gegründeten Deutschen Reporterpreises gebeten worden war; ins Leben gerufen von Cordt Schnibben, Stephan Lebert, Ariel Hauptmeier und anderen mit dem Ziel, der eigenen Profession zu neuem Glanz und Schwung zu verhelfen. Ein bisschen auch, so schien mir, um der anschwellenden Depression der schreibenden Zunft entgegenzuwirken.
Glänzende Reporter in wenigen Titeln
Finanziert wird der Preis von einer Stiftung, er ist unabhängig, weil von denjenigen vergeben, die ihn am liebsten auch selbst gewinnen würden, also keines der vielen Marketing-Instrumente, mit denen Verlage und Sender seit Jahren Aufmerksamkeit zu erheischen suchen.
Der Jury anzugehören, war nicht nur kurzweilig, es war auch erkenntnisreich. Von den 624 eingereichten Veröffentlichungen blieben nach Sichtung durch Vorjurys 48 Arbeiten übrig (1/2/3/4), die einen repräsentativen Blick auf unsere Zunft erlaubten, der mich froh stimmte, andererseits auch erschreckte. Froh, weil etliche Texte beste Recherche, ungewöhnliche Beobachtungen und scharfsinnige Analysen lieferten. Glänzende Reporterarbeit also.
Erschrocken, weil die preiswürdigen Arbeiten in nur noch wenigen Blättern erschienen waren. Die meisten in „Spiegel“ und „Zeit“, die ihre Spitzenstellung bei der recherchierten Reportage immer weiter ausbauen, einige in der „Süddeutschen Zeitung“ und dem dazugehörenden Magazin, wenige in „Brand eins“, „Focus“ oder „Stern“. In der publizistischen Ebene scheint der Ehrgeiz, erstklassige journalistische Arbeit abzuliefern, nur noch in Spurenelementen vorhanden.
Was folgern wir daraus? Dass der fast täglich prophezeite Untergang von Zeitungen und Zeitschriften schon tiefe Spuren hinterlassen hat (self-fulfilling prophecy) und in der Verlagslandschaft ein Überlebenskampf tobt, in dem controllinggetriebener Sparwille gegen journalistische Inhalte ausgespielt wird?
Warum, so muss weiter gefragt werden, waren „Frankfurter Allgemeine“ und „Welt“ sowie die großen regionalen Tageszeitungen mit keiner oder gerade mal einer preiswürdigen Arbeit präsent? Haben die Journalisten aus Jobangst resigniert oder in vorauseilendem Gehorsam gegenüber den Kaufleuten die arbeitsaufwändigen Themen gar nicht erst in die Redaktionskonferenz getragen?
Klar, es gibt Sorgen und die sind manches Mal mehr als berechtigt. Es fördert journalistisches Engagement nicht gerade, wenn ein großer Tageszeitungsverlag, wie DuMont Schauberg wegbrechende Anzeigenerlöse durch Zusammenlegung von Ressorts zwischen Köln („Stadt-Anzeiger“), Berlin („Berliner Zeitung“) und Frankfurt („Frankfurter Rundschau“) zu kompensieren sucht.
Aber mit dem gebetsmühlenartigen Ruf nach Erhalt der Autonomie werden die Kassen auch nicht voller – und die Verleger nicht williger. Ganz abgesehen davon, dass es für einen an Aufklärung und Öffentlichkeit interessierten (wofür arbeiten wir?) Reporter nur gut sein kann, wenn seine Geschichte parallel in drei Ballungsgebieten gedruckt wird und Wirkung entfalten kann.
Manipulationsskandale im Kopf
Warum also, frage ich mich, reagieren die betroffenen Kolleginnen und Kollegen nicht offensiver auf die vertrackte Situation: Wenn die Verlagsmanager Personalkosten einzusparen gedenken, dann könnten sie doch einen Teil der frei werdenden Gelder in die Qualität des Auftritts investieren. Oder anders gefordert, mindestens die Hälfte der gesparten Euros sollten für investigative Geschichten bereitgestellt werden. Das nützte Ansehen und Erfolg aller drei Blätter, denn sie würden besser und unverzichtbarer; das hilft dem Verlag sogar bei der gebührenpflichtigen Vermarktung im Internet.
Ein ausgereifter Artikel voll Individualität, Kreativität und somit Qualität ist für das Überleben des Journalismus und seiner Abspielbasen wichtiger, als dreimal mittelmäßiger Standard. Er schafft zudem Glaubwürdigkeit, Professionalität, Exklusivität und Unabhängigkeit. Das sind schließlich entscheidende Vorteile des Journalismus. Selbst im Internet, das mit jedem Tag stärker von PR und Unternehmensprosa durchwirkt und beherrscht wird. Wir haben die Manipulationsskandale im Kopf. Stichwort Wikipedia. Die Suchmaschinen unterscheiden nicht nach Qualität und Faktentreue – da hat das manipulierte Falsche ebenso seine Chance, wie das recherchierte Wahre.
Informationsflut bändigen
Es ist wenig überraschend, wenn im Netz vor allem die Blogs erfolgreich sind, die von großen journalistischen Marken entwickelt und verbreitet werden. Denkbar sind sie meist sowieso nur, weil viele der journalistischen Texte noch für Print, TV oder Radio erarbeitet und durch sie finanziert werden. Das Internet dient gerade mal als zusätzlicher Vertriebskanal, der allerdings über die Jahre die Chance hat, die verloren geglaubten Werbegelder wieder in die Verlage zurückzuholen. Warum sollte es sich nicht eines Tages umkehren und erfolgreiche Internetauftritte Printmedien subventionieren?
Wozu also Journalismus? Die Antwort kennt jeder. Weil ohne Aufklärung, und für die sorgen zuallererst die Journalisten, das demokratische Miteinander und übrigens auch die soziale Marktwirtschaft gefährdet sein würden. Ein großer Satz, ich weiß es wohl, aber er kann nicht oft genug gesagt und geschrieben werden. Die Bürgerinnen und Bürger sind in der komplexer werdenden Welt darauf angewiesen, dass es gut ausgebildete Redakteure und Schreiber gibt, die ihnen eine Schneise durch den Informationsdschungel schlagen. Es gehört zum Berufsfeld des Journalisten, die Flut der Informationen zu bändigen und sie fürs Publikum sachgerecht zu sortieren und aufzuarbeiten.
Wenn erst mal die Lobbyisten, gleich welcher Couleur, die Macht über die veröffentlichte Meinung gewinnen – egal, ob in Zeitung, Zeitschrift, Radio, Fernsehen oder über zielgerichtete Webseiten -, dann ist der Indoktrination Tür und Tor geöffnet. Mit all den unübersehbaren Folgen für das freie Wort und das unabhängige Urteil. Dabei sollten die Kolleginnen und Kollegen ruhig mal die ihnen nur zu gern zugewiesene Rolle als „Merker“ verlassen, das heißt, es nicht allein beim Abmalen der Wirklichkeit belassen und lieber mal als „Täter“ Einfluss zu nehmen suchen.
Hier Sozialismus, dort Kapitalismus
Mir sei an dieser Stelle ein Zwischenruf erlaubt, der meiner Vergangenheit geschuldet ist: Bis in die 1980er Jahre hinein war die journalistische Täterschaft durchaus üblich. Ja, sie war sogar sehr erfolgreich. Da kämpften beispielsweise „Stern“, „Spiegel“, „Zeit“, „Süddeutsche“ oder „Frankfurter Rundschau“ für eine liberalere, eine offenere Welt. Sie wollten den autoritären Stil der Adenauer-Jahre hinter sich lassen, den wiederum „Bild“, „Welt“, „Quick“, „Bunte“ oder „FAZ“ mit Inbrunst zu verteidigen suchten.
Das Ergebnis war eine heftige, öffentliche Auseinandersetzung, aber eben auch fruchtbarer Streit. So sorgte beispielsweise das Für oder Wider zur Ostpolitik von Willy Brandt und Walter Scheel dafür, dass am Ende beide Lager, das sozialliberale wie das konservative, davon zu profitieren wussten und die Fronten – hier Sozialismus, dort Kapitalismus – langsam aber sicher erodierten.
Den Streit ausgetragen und zu einem positiven Ende (Wiedervereinigung) geführt zu haben, war aber nicht allein das Verdienst einiger Politiker, wie Brandt oder Hans-Dietrich Genscher, Helmut Schmidt oder Helmut Kohl, sondern es waren auch große Journalisten-Verleger wie Rudolf Augstein, Henri Nannen, Marion Gräfin Dönhoff, Werner Friedmann und Karl Gerold links der Mitte, sowie Axel Springer, Peter Boenisch, Paul-Wilhelm Wenger, Herbert Kremp, Hans Habe, Hans Zehrer, Karl Ludwig Fromme, Wilfried Hertz-Eichenrode rechts davon. Beide Lager brillierten durch Haltung, Passion und Vision.
Die sich daraus entwickelnden Schlachten faszinierten die Leser. Sie bescherten den Lesern interessante Geschichten und den Verlagen Aufmerksamkeit, Anerkennung und damit wirtschaftlichen Erfolg. Der Kampf der Argumente beflügelte die Leidenschaft der Redakteure, er steigerte die Auflagen und animierte sogar die Anzeigenkunden.
Der Journalismus lebte und es wäre niemandem eingefallen, den eigenen Untergang zu prophezeien, obwohl sich auch damals mit dem Start des Privatfernsehens und seinen unendlichen Kanälen eine neue Macht am Medienhimmel etablierte und große Teile des Werbekuchens okkupierte. Und bitte sage jetzt keiner, es gäbe die großen, strittigen Themen heute nicht mehr. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan oder radikale Schlussfolgerungen aus der Finanzkrise sind nur zwei Themen, die sich vorzüglich für heftigste Auseinandersetzungen eigneten.
Will sagen: Soll der Journalismus zu neuer Blüte kommen, darf er sich nicht länger zurückpfeifen lassen. Gefragt ist die Kunst der Zuspitzung, die der Wahrheitsfindung dienlicher ist als jedes Kompromissgebrabbel. Und beendet werden muss das künstliche Gegeneinander der Vertriebskanäle Print, Radio/TV und des Internets. Es gilt, gemeinsame Standards für Inhalte und Qualität zu entwickeln. Standards, die von im Internet dilettierenden Laien- Bloggern, Leserreportern oder PR-Spezialisten nicht erfüllt werden können. So jedenfalls ließe sich die exponierte Stellung des Journalistenberufs verteidigen.
Wie erfolgreicher Journalismus immer besser werden kann, führt die „Seite 3“ der „Süddeutschen Zeitung“ vor, die dank des Engagements ihrer Redakteure und Reporter von Woche zu Woche neuen Höhepunkten entgegeneilt. Sie liefert zudem den Beweis, dass Print dem Internet immer überlegen sein wird. Wenn dann auch noch Haltung hinzukommt, und ich meine das ausdrücklich nicht ideologisch, dann ist mir um unsere Zukunft nicht bange – egal, auf welchen Kanälen wir Triumphe feiern.
Ohne Journalismus keine Demokratie
Unsere Zunft hat in den vergangenen Jahrzehnten manche Krise durch großartige Leistungen überstanden. Gefördert und veranstaltet durch kreative Verlage und mutige Verleger, aber erarbeitet vor allem von denen, die den Medien erst den Glanz verliehen, den Reportern, den Autoren, den Redakteuren. Ohne sie kein Journalismus und ohne Journalismus keine Aufklärung und ohne Aufklärung keine Demokratie. So einfach und so pathetisch ist die Formel.
Insoweit war für mich die Gründung des Deutschen Reporterpreises eine Ermutigung, auf dem schwierigen Weg, den der Journalismus noch vor sich hat, will er nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken. Merke: Auch Eliten überleben nur durch Selbstvergewisserung.
Ursprünglich ist dieses Essay als Teil der „SZ“-Reihe „Wozu noch Journalismus“ erschienen, die auch als Buch erhältlich ist. VOCER veröffentlicht ausgewählte Beiträge in teils leicht aktualisierter Form.
