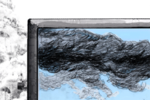
Die Krise, das sind wir selbst
Krisen, internationale Brandherde, Katastrophen, politische Zuspitzungen – eigentlich, so möchte man meinen, sind das Situationen, in denen der Journalismus seine Trümpfe so richtig ausspielen kann: Aktualitätsbezogen und faktengesättigt wird der Leser/Zuhörer/Zuschauer mit „Breaking News“ und Sachstandsberichten versorgt, mit Hintergründen und Einordnungen, mit Positionen und Meinungen.
Der Korrespondent als souveräner Berichterstatter, der seine Heimatredaktion material- und kenntnisreich mit den Produkten seiner journalistischen Kunst versorgt: Dieses Bild gefällt vielen Medien-Protagonisten zu sehr, um es einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.
Dabei wäre genau jene kritische Würdigung dringend angezeigt – denn allzu oft hat sich, als sich der Pulverdampf der Aktualität verzogen hatte, ein schales Gefühl eingestellt: Gespeist aus dem journalistischen Bauchgefühl, wieder einmal nur den unreflektierten Durchlauferhitzer des Tagesgeschehens gegeben zu haben, hinterlässt die mediale Behandlung von Krisen häufig den Eindruck, nicht gerade der souveränsten journalistischen Vorstellung beigewohnt zu haben.
Zu schnell, zu voreilig, zu dramatisch, zu unreflektiert, zu hilflos gegenüber den üblichen journalistischen Schnappreflexen: Das müssen sich so manche Redaktionen vorwerfen lassen. Auch diejenigen, die das Mantra „Präzision vor Schnelligkeit“ geradezu ostentativ vor sich hertragen.
Zwischen präzisen Analysen und hanebüchenen Fehlern
Das klingt wie ein Vorwurf. Ist aber keiner. Um es ganz klar zu sagen: Sowohl in der Berichterstattung über die Anschläge vom 11. September 2001, über die Revolution in der arabischen Welt als auch über den Tsunami in Japan ist viel Gutes geschrieben und gesendet worden. Hintergründige Analysen, verlässliche Live-Berichterstattung unter hohem Zeit- und Erwartungsdruck, erhellende Einordnungen – das war eher die Regel als die Ausnahme.
Das soll jedoch nicht die teilweise hanebüchenen Fehler entschuldigen. Ob man fehlerhafte Berichterstattung allein dem Fernsehen attestieren kann, wie Ranga Yogeshwar es beim „Berliner Medien-Diskurs“ der Konrad-Adenauer-Stiftung tat – er warf TV-Journalisten vor, eine „miserable Rolle gespielt“ zu haben -, sei mal dahingestellt.Denn letztlich sind alle Journalisten, unabhängig von der Darreichungsform, zunehmend Player in einer Disziplin, die von den Faktoren Unübersichtlichkeit, Aktualitätsdruck, Angebotskonkurrenz und übermächtigem Interpretationsbedürfnis geradezu in die Enge getrieben wird. Man kann sich darüber ärgern. Man kann darüber jammern. Es hilft nichts – die Muster bleiben.
Eine Familienaufstellung.
Faktor 1: Nur eine Krise, die sich ausdrucksstark bebildern lässt, ist eine bedeutsame Krise.
Es ist bemerkenswert, wie sehr unsere Wahrnehmung von Krisenfällen über die optische Repräsentanz des Geschehens funktioniert. Fotos werden aufgeladen mit ereignisfernen Bedeutungen und kulturell determinierten Interpretationen – und lösen sich schließlich von dem Ereignis, das sie eigentlich illustrieren sollen. Bilder brennen sich ins Gedächtnis, werden zu Symbolen nicht nur für ein Ereignis, sondern auch für dessen Auswirkung, Bedeutung, Interpretation.
Die Fassaden-Trümmer des World-Trade-Centers, die ähnlich dem Maßwerk einer gotischen Kathedrale aus einem Hügel aus Schutt in den grauen Himmel ragen: ein Sinnbild für die apokalyptische Wucht, mit der der islamistische Terror in die westlich Welt eingebrochen ist. Die berstende Verkleidung des Reaktors 1 von Fukushima: ein grobpixeliger Beleg für die Unbeherrschbarkeit der Atomenergie.
Ohne solche plakativen, ikonischen Bilder wird es schwer, eine Krise in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Eine so schwerwiegende Entwicklung wie die im Bereich der Biodiversität etwa, wo durch menschlichen Einfluss täglich etwa 70 Tier- und Pflanzenarten unwiderruflich verschwinden, hat (noch) keine angemessene optische Repräsentanz gefunden, um das gesellschaftliche Bewusstsein zu verändern. Es ist kein Zufall, dass Umwelt- und Naturschützer auf wirkmächtigere Bilder wie beispielsweise von den brutalen Praktiken des Walfangs setzen.

Illustration: Rita Kohel
Eine zusätzliche Bedeutung bekommt diese Bildfixiertheit im Zeitalter der Foto-Handys, weil nun auch Bilddokumente von Ereignissen zur Verfügung stehen, die zuvor von keinem Kameramann aufgenommen worden wären. Die Zufallsbeobachtung, die gefilmt und ins Netz gestellt wird, behauptet sich zunehmend auf dem Bildermarkt. Die Konsequenzen für den Journalismus: Man hat es zunehmend mit Dokumenten zu tun, deren Herkunft man nicht kennt, deren Entstehungszeit und -umstände unbekannt sind, ja deren Bildmotive sich oft nicht eindeutig bestimmen lassen.
Transparent sein oder die Ausstrahlung sein lassen
Es ist erstaunlich, wie oft solche Filmchen in Nachrichtensendungen zu sehen sind, betextet mit Verortungen und Einordnungen, die im günstigsten Fall nur vage, im schlimmsten Fall überhaupt nicht verifiziert wurden. Nun wird keine Redaktion den Zuschauern sagen: „Wir haben da was, wissen aber nicht, was es genau ist. Wissen nicht, wer da auf wen einschlägt. Wer diese Menschen sind, die ihre Waffen vor der Handy-Kamera schwenken.“ Doch solange man dies nicht tut, hilft eigentlich nur eines: die Ungewissheiten und Vorbehalte benennen. Oder es gleich ganz sein lassen mit der Ausstrahlung.
Ein weiterer Nebenaspekt der Bildfixiertheit: Die Bilder von Übergriffen auf U-Bahn-Bahnsteigen wurden meist von Überwachungskameras aufgezeichnet. Hier kommt es zu der paradoxen Situation, dass ausgerechnet Einrichtungen, die zur Sicherheit des öffentlichen Raumes beitragen sollen, nun dafür sorgen, dass medial ein Gefühl von Bedrohung und Verunsicherung generiert werden kann. Das Mittel zur Bekämpfung der Gefahr wird zum Resonanzboden der Angst vor der Gefahr.
Faktor 2: Die oft beschworenen „Hintergründe und Einordnungen“ sind hilflose Kulturerklärerei, verbunden mit Kaffeesatzlesen und gewürzt mit Vorurteilen.
Unmittelbar nach dem Erdbeben in Japan und der daraus resultierenden Reaktor-Havarie in Fukushima fokussierte sich die Diskussion hier in Deutschland auf die Risiken der Atomkraft. Gespeist aus den Erfahrungen von Tschernobyl, als ein Reaktorunglück einen ganzen Landstrich verwüstete und Länder, die Tausende von Kilometern vom Unglücksort entfernt lagen, mit den Folgen des radioaktiven Fall-outs konfrontierte, wurde für das dicht besiedelte Japan ein ähnliches Schreckensszenario angenommen. Allein: Die Japaner wollten einfach nicht so panisch reagieren, wie die Deutschen ihnen das nahe gelegt hatten.
Von Tag zu Tag wuchs das Unverständnis über die japanische Gelassenheit angesichts des Reaktor-Unglücks. Ein Kommentator auf „tagesspiegel.de“ forderte, ganz Japan zu evakuieren, notfalls mit militärischer Hilfe von außen, und zeigte sich empört darüber, dass „die Japaner“ partout nicht in Panik verfallen wollten.
Mediale Erklärungsversuche
Gleichzeitig versuchten viele Zeitungen und Zeitschriften, das vergleichsweise gelassene Verhalten in Japan kulturhistorisch herzuleiten. Das, was sie als Erklärstücke lieferten, waren regelrechte Hochämter der angewandten Kulturpsychologie.
Am dollsten trieb es der „Stern“ in seiner Titelgeschichte vom 24. März, „Stolz, diszipliniert, leidensfähig, selbstlos: Das unglaubliche Volk – wie Kultur und Katastrophen die Mentalität der Japaner prägen“. Das Magazin wagte einen Erklärungsversuch für die Duldsamkeit der Japaner, die Samurai und die Kamikaze-Flieger; eine Möglichkeit, um zu verstehen, wie sehr unzugängliche Phänomene auf bekannte Deutungsmuster reduziert werden müssen, um sie zumindest oberflächlich zu erklären und arrondieren zu können.
Solche kulturorientierten Deutungen sind immer unscharf, pauschalisierend und nah am Klischee. Als Erklärungsmodelle taugen sie nur bedingt – denn die kulturelle Wahrnehmung dient immer auch als Spiegel der eigenen Erfahrungswerte und Vorstellungen und nimmt die beobachtete Welt nur selten immanent wahr. Dadurch werden eigenen Vorstellungen und Wertesysteme unbewusst aufgegriffen.
Man erkennt das sehr schön, wenn man gleiche Bilder von unterschiedlichen Orten vergleicht. Eine überfüllte U-Bahn in München: Ui, da wollen aber viele Leute zur Arbeit! Eine überfüllte U-Bahn in Tokio: Maschinenmenschen! Unerbittliches System! Ameisen! Kultur der Anpassung und der Schicksalsergebenheit!„Japan, das wird in diesen Tagen klar, ist uns viel rätselhafter, als wir bislang glaubten“ – so schrieb der „Stern“ in besagter Titelgeschichte. Hier wirkt sehr stark das Prinzip der relativen kulturellen Nähe – die in diesem Fall eine kulturelle Distanz ist. Der japanische Regierungssprecher in seinem blauen Arbeits-Overall wirkte hierzulande wie eine schlechte Maskerade, wie das Vorgaukeln von technischer Kompetenz, wie das Surrogat von Technik-Beherrschung.
Faktor 3: Beziehungswahn
Es wirkte wie ein Stück Comedy in einer todernsten Situation: Da hatte Ranga Yogeshwar engagiert und bilderreich die komplexen Vorgänge im Inneren der havarierten Reaktoren von Fukushima erklärt, als – ein Call-In schloss sich an – eine besorgte Anruferin formulierte, was in Deutschland schon bald zentraler Diskussionsgegenstand werden sollte: Dieses Unglück da in Japan – kann man jetzt noch unbesorgt Sushi essen?
Es ist eine perfide Form von Beziehungswahn: Was bedeutet das für uns hier? Was in den achtziger Jahren noch ein probater Kniff des Lokaljournalismus war, um Gesichter der regionalen Leserschaft ins Blatt zu hieven und damit eine Identifikationsfläche für Menschen aus der Region zu schaffen („Der Benzinpreis steigt – wie ändert sich Ihr Tankverhalten?“ – „Mir egal, ich tanke eh immer nur für 25 Mark“ – Alois K., Saarlouis), geriet rasch nach dem Reaktorunglück von Fukushima zu einem Horrorkabinett deutscher Befindlichkeiten.
Gespeist aus der Vorstellung, dass nun ganz Japan radioaktiv verseucht sein müsse, wurde das gesamte hiesige Konsumverhalten durchdekliniert. Offenbar hat Europa die Lektion von den Steinpilzen nach Tschernobyl gelernt. Zusätzlich gespeist werden diese Zusammenhangsfantasien durch das Gefühl, den Stürmen einer globalisierten Welt hemmungslos ausgesetzt zu sein.
Kann man also auch nach Fukushima Sushi essen? Ja, man kann. Der Fang, der aus der Gegend um Japan stammt, gelangt nicht auf die hiesigen Märkte. Genauso, wie man nach Fukushima Autos von Honda kaufen oder Musik von Takemitsu hören kann.Faktor 4: Die mediale Kompetenz von Experten
Es ist generell ein gutes Zeichen, dass in unübersichtlichen Krisen-Zeiten Experten befragt werden, um eine Analyse zu leisten. Die Auswahlkriterien für Experten bemessen sich jedoch nicht allein am fachlichen Sachverstand des Gesprächspartners. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist die Eignung des Experten, möglichst allgemeinverständlich und pointiert formulieren zu können.
Das ist eine durchaus legitime Praxis, allerdings hat sich auf dem Expertenmarkt eine Tendenz herausgebildet, wonach die Fähigkeit zur knackigen Formulierung und die Bereitschaft zur frühzeitigen Festlegung ein bevorzugtes Kriterium für die Expertenauswahl geworden ist. Das ist solange in Ordnung, wie die fundierte inhaltliche Annäherung im Vordergrund der Expertenbefragung steht. Schwierig wird es, wenn die Art und Weise der Darbietung wichtiger wird als deren Inhalt.
Gerade der Fall Fukushima hat gezeigt: Die Deutschen sind nicht nur ein Volk von Fußball-Bundestrainern und Bahn-Chefs – sondern auch ein Volk von Reaktorexperten. Die Kern-Schmelze, der Super-GAU: Auch ohne verlässliche Informationen wurden diese Krisen-Ereignisse von Experten herbeifabuliert, herbeierklärt. Widerspruch? Zwecklos – ganz nach dem Motto: „Dürfens ein paar Mikrosievert mehr sein?“
Das hängt auch damit zusammen, das die Figur des „Experten“ in seinem medialen Auftritt ein allwissender Wissenschaftler zu sein hat, der letzte Zweifel beseitigt und verbindliche, dauerhafte Analysen und Erklärmodelle anbietet. Eine solche Funktionszuweisung verkennt, dass Wissenschaft immer diskursiv funktioniert, eher ein Prozess ist als eine Erkenntnisfestschreibung, und letztlich vom Wettbewerb und vom sportlichen Gegeneinander der Argumente und Positionen lebt. Wissenschaftler, die diese Prinzipien um einer höheren Medienpräsenz willen über Bord werfen, tun nicht nur der Medienöffentlichkeit, sondern auch der Wissenschaft selbst keinen guten Dienst.
Und nun?
Nun wäre es an der Zeit, das hohe Mantra von journalistischer Sorgfalt und Recherchefreude anzustimmen. Dies ist jedoch eine Arbeitsanweisung 1.0, ein Gebot aus einer Zeit, in der Konkurrenz- und Aktualitätsdruck vergleichsweise überschaubar waren. Doch nun, im Zeitalter der Live-Ticker, des Twitter-Gewitters und der Echtzeitverbreitung von Beobachtungs- und Erkenntnispartikeln, ist die Annahme obsolet, erst nach eingehender, gründlicher Prüfung dürfe eine Nachricht dem geneigten Publikum weitergegeben haben. Jeder, der sich auf einer Redaktionskonferenz einmal dem Vorwurf „Warum haben wir das nicht?“ ausgesetzt sah, weiß um das Aktualitätsgerangel des modernen Journalismus.
Es mag helfen, einen Schritt zurückzutreten – um aus gebührender Distanz zu erkennen, dass die Herausforderungen des Journalismus 2.0 auch im Krisenfall mit dem konventionellen Instrumentarium von journalistischer Klarsicht und handwerklicher Sauberkeit gemeistert werden können – wenn man es denn konsequent anwendet. Am Anfang steht die Einsicht in das Rollen- und Rudelverhalten bewegter journalistischer Massen. Daraus ergibt sich praktisch alles Weitere:
YouTube-Filmchen und Twitter-Wortmeldungen sind journalistische Quellen – und verdienen es, als solche behandelt zu werden. Dazu gehören die Recherche, woher die Quelle stammt, sowie eine Prüfung auf Plausibilität. Allein mit diesen beiden simplen Maßnahmen hätte beispielsweise keine Redaktion auf die Fake-Twitter-Accounts bei der letzten Bundespräsidentenwahl hereinfallen müssen, als sich ein Netz-Kobold als Martina Gedeck ausgegeben hatte.
Es ist unprofessionell, wenn Redaktionen – getrieben von dem Bemühen, um jeden Preis „modern“ und „zukunftsgerichtet“ zu arbeiten – auf simpelste Recherche verzichten, nur weil sie mit Schwitzehändchen die Produkte des Web 2.0 anpacken.
Liveticker-Manie
Der in Krisenfällen sehr beliebte Live-Ticker hat sich bewährt, um Geschehnisse chronologisch und entwicklungssystematisch abzubilden. Nur muss man sich bewusst sein, dass er das Potential zur Dramatisierung von Ereignissen in sich birgt. Bei einem Fußballspiel mag das ein erwünschter Effekt sein – nur muss man sich als verantwortungsbewusster Journalist darüber im Klaren sein, dass Krisen und Katastrophen selten der Dramaturgie von Sport-Großereignissen folgen. Auch ist die chronologisch-entwicklungssystematische Darstellung ohne eine profunde Einordnung und Analyse wertlos.
Gerade die Berichte über das Reaktorunglück von Fukushima hat gezeigt, dass kulturhistorische Deutungen weniger Erklärungen, als vielmehr ausformulierte Vorurteile waren. In diesem Fall war zudem wenig hilfreich, dass sich Korrespondenten auf fragwürdige Quellen und zweifelhafte Kolportagen verlassen haben – stellvertretend soll hier Robert Hetkämper erwähnt werden, der sich bei den ausharrenden Arbeitern im Reaktor I an den „Führerbunker am Ende des zweiten Weltkriegs“ erinnert fühlte. Hetkämpers Arbeitsweise ist viel gescholten worden – das soll nicht ein weiteres Mal aufgewärmt werden. Dass seine Berichte auf solch ein großes Echo in Deutschland gestoßen sind, hängt damit zusammen, dass er mit seinen gefühligen, küchenpsychologischen Deutungen genau die Vorstellungen bedient hat, die die Agenda in Deutschland geprägt haben.
Zu guter Letzt: Sowohl Experten als auch Korrespondenten sollten sich einige ganz einfache Formulierungen ins Gedächtnis rufen: „Das weiß ich nicht. Das kann man noch nicht sagen. Für solche Aussagen ist es noch zu früh. Alles andere ist Spekulation.“ Dann klappt’s auch mit der Krisenberichterstattung!
