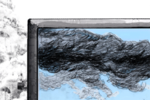
Hört auf, euch selbst zu bemitleiden
Beim folgenden Text handelt es sich um ein einmaliges Sonderangebot, denn er kann sowohl als Nestbeschmutzung wie als Nestbereinigung verstanden werden. Letztendlich geht es um eine Familienangelegenheit. Die in gedruckten oder versendeten Nachrufen auf die „Frankfurter Rundschau“ und die „Financial Times Deutschland“ verkündete Krise des Journalismus ist nämlich erstens nicht neu, weil es die gibt, seit die ersten Journalisten, die Jünger Jesu, ein Publikum für ihre Botschaften suchten. Und die Krise ist zweitens nicht ausschließlich die Schuld der für Journalisten üblichen üblen Verdächtigen, zum Beispiel der Redaktionen zusammenlegenden oder Spesen für notwendige Recherchen kürzenden Manager.
Wenn sich ein Geschäftsmodell durchsetzt, das vorsieht, dass ein einzelner Chefredakteur, offensichtlich hoch begabt, ein Blatt pro Werktag verantwortet und am Sonntag auch noch die Versuchsküche seines Großverlages leitet, kann man sich tatsächlich am Ende alles sparen. Wenn im Streit zwischen publizistischem Auftrag und ökonomischen Zwängen immer nur die Ökonomie gewonnen hätte, dann wären viele große Verleger heute nichts weiter als eine Fußnote der Nachkriegsgeschichte. So betrachtet wird die Medienbranche zukünftig überhaupt doch viel ertragreicher ohne Journalisten, nicht wahr?
Nicht wahr. Oder unterhalten mit jenen Billigkräften, die das glauben, was ihnen sogenannte Fernakademien versprechen. Auf einer Homepage beispielsweise wird „von Grund auf das A und O für erfolgreichen Journalismus“ angeboten. Sowohl „für Berufsanfänger“, als auch für jene, „die ihre journalistischen Fähigkeiten ausbauen wollen“. Wer den zwölf Monate dauernden Schnellkurs bezahlt hat, kann sich „fachlich kompetent und journalistisch stilsicher ausdrücken“ und ist damit „bestens gewappnet, um Redaktionen mit journalistischem Können zu überzeugen und attraktive Karrierechancen in der Medienwelt wahrzunehmen.“ Nach „erfolgreicher Bearbeitung aller Einsendeaufgaben gibt es als Nachweis der erworbenen Qualifikationen das Fernakademie-Zeugnis Journalist/in“, als „Certificate“ gern auch auf Englisch.
Doch die Krise des Journalismus ist auch eine Krise der Journalisten, also mitunter selbst verschuldet und nicht stets Schuld der anderen (der Leser zum Beispiel, die online das Weite suchten statt die Nähe des Zeitungsladens). Die beiden am Kiosk Ausliegenden, dem Tod Geweihten, hinterlassen trauernde Angehörige der Familie Journalismus. Wer nimmt sie auf und in die Arme? Wer bietet den jetzt Entlassenen, so viele Talente, so viele hoffnungsvolle Junge, so viele erfahrene Alte… auf dem weiten Feld Journalismus, das eben nicht nur gedüngt werden darf von Renditebauern, noch eine Zukunft?
Zeitungen bleiben unersetzlich
Jede Zeitung von heute ist morgen immer noch nützlich, um am Marktstand mit den Sportseiten Fisch einzuwickeln oder zu Hause mit dem Wirtschaftsteil nasse Stiefel auszustopfen oder abends mit dem Feuilleton das Kaminfeuer zu entzünden. Gedruckte Zeitungen bleiben deshalb weiterhin unersetzlich.
Wenn alle Qual der Guten den Tod nicht verhindern konnte, weil potenzielle Leser sich mit dem begnügten, was sie kostenlos im Netz fanden, kann das Ende von „Frankfurter Rundschau“ und „Financial Times Deutschland“ nicht einfach damit begründet werden, dass in der digitalen Welt die „brutale winner-takes-it-all-Regel“ herrscht (Manager Marc Walder vom Schweizer Ringier-Verlag zur Süddeutschen Zeitung). Denn Qualität entfaltet sich in allen Formen. Und für neue Geschäftsmodelle sind nicht wir Journalisten zuständig, sondern die Manager. Wir fragen ja auch nicht bei denen nach, wie man recherchiert, enthüllt, schreibt.
Bei den Recherchen in die verlorene Vergangenheit und in die bedrohliche Gegenwart gilt deshalb die journalistische Binsenregel, nichts zu glauben von dem, was verkündet wird und alles in Zweifel zu ziehen. Grau ist die Farbe des Zweifels, und sie steht Reportern gut. Die Verlagsmanager, jahrzehntelang als natürliche Gegner der Journalisten gegrüßt und von Axel Springer „Flanellmännchen“ genannt, sind in den beiden aktuellen Fällen vom Vorwurf aktiver Sterbehilfe freizusprechen. Sie haben für die Krankenpflege und die Operationen teuer bezahlt.
Mitleid jedoch ist auch nicht angebracht. Denn die von ihnen geleiteten Verlage haben in fetten Jahren wie einst die genuinen Verleger ihren „Champagner aus Gehirnschalen der Journalisten schlürfend“ (Erich Kuby) Milliarden verdient – und es im Rausch der eigenen Bedeutung versäumt, Rücklagen zu bilden für schlechte Zeiten. Dafür büßen jetzt Journalisten.
Der wunderbarste Beruf der Welt
Die Schaumschläger unter den Kaufleuten müssten die Erfüllung ihrer Ambitionen suchen als Autoverkäufer, Makler, Investmentbanker – wenn sie nicht mehr in der Medienbranche auftreten dürften. Sie brennen nicht für „all the news that’s fit to print“ (das Leitmotiv der immer noch berühmtesten Zeitung der Welt, der „New York Times„) und für die Geschichten der Menschen hinter Nachrichten, sondern für einen satten Deckungsbeitrag III in der Jahresbilanz, der ihnen Glamour unter ihresgleichen verleiht. Ohne die Software Journalismus würden ihnen jedoch die Produktionsmittel fehlen. Begreifen müssen sie den Beruf der Eigenartigen zwar nicht. Es gibt da keine Zertifikate wie nach dem Studium der Betriebswirtschaft. Aber Respekt sollten sie zeigen. Einige der drei, vier, fünf Guten immerhin haben das begriffen.
Es mag sich derzeit zwar nicht auszahlen, aber es lohnt sich, für den wunderbarsten Beruf der Welt – einmal abgesehen von dem der Queen oder des Papstes – zu kämpfen. Denn man wurde und wird bezahlt für das, wofür es sich zu leben lohnt: denken, lesen, schreiben. Die Behauptung, dass viele, die sich als Journalisten bezeichnen, den wunderbaren Beruf schwänzen, ist aber ebenfalls belegbar. Gemeint sind nicht die Leichenfledderer englischer Tabloids, mit denen verglichen „Bild“ oder „Super-Illu“ intellektuell so anspruchsvoll erscheinen wie die „International Herald Tribune„. Sondern die vielen, die ihren Job so ausüben, als könnte es zur Not jeder andere sein, die Mut, Talent und Leidenschaft ersetzt haben durch Faulheit, Eitelkeit, Phantasielosigkeit.
Das Journalismus-Haus
Wer schreibt, der bleibt. Ein Zitat, das dem heiligen Monster Rudolf Augstein zugeschrieben wird. Wie ließe sich also ein Gebäude beschreiben, in dem alle untergebracht sind, die Gattung der Journalisten ? So vielleicht:
Ein mehrstöckiges, graues Haus. Draußen ein Schild mit der Aufschrift Journalismus GmbH. Ein ungesicherter Eingang. Eine breite Treppe, an deren Ende Hinweise auf die einzelnen Abteilungen zu sehen sind. Unten im Keller kriechen Sprachlose, denen das Himmelreich gewiss ist, denn selig sind die Armen der Yellow Press, deren Namen keiner nennt und keiner kennt.
Im Hochparterre sitzen betörend aufgebrezelte Journalistenmodels, die unermüdlich ihren Verlagen Mehrwert schaffen, indem sie die leeren Seiten zwischen Anzeigen füllen. Ihre Tipps und Trends halten sie für Texte. Sie bauen – ewig singen die Wälder sprießender Haare – auf eine stets nachwachsende Zielgruppe, die sich bei Friseuren trifft.
Darüber, auf der Beletage, haben Wörter zwar noch immer keine sichere Herberge, aber die Redakteurinnen sprechen die Sprache der Manager und die verstehen sich als gleichberechtigte Ideengeber für Galas oder Buntes. In den aufgerüsteten Abstellkammern erklären Medienwissenschaftler den eigentlich wahren Journalismus, dessen Rezepte und Küchen ihnen stets persönlich zu heiß gewesen sind. Weshalb sie die Beamtenlaufbahn wählten und seitdem bei jeder Krise in leeren Kirchen predigen.
Im Mezzanin sitzen die Erfolgsfrauen der „Landlust„, weil sie zwar ein Rezept für ihr Blatt erfunden haben, dessen Zubereitung Millionen schmeckt, jedoch mit klassischem Journalismus, ohne den es keine demokratische Verfassung gibt, keine liberale Gesellschaftsordnung, so viel zu tun hat wie der Apostel Matthäus mit Lothar Matthäus. Die Reaktion verblüffter Medienprofis aus den Städten waren Me-too-Produkte, die alle irgendwas mit Land im Titel tragen, aber dem Original nicht das Regenwasser und die Strickliesel reichen können.
Einige dem Alter trotzend wahnsinnig gebliebene Journalisten aus dem ehemaligen Zonenrandgebiet um Lüchow-Dannenberg produzierten ihre private Antwort auf die Krise, nannten ihr Heft „Landluft“ und sind bereits tief in den schwarzen Zahlen. Ihr Verleger ist der Wirt ihrer Stammkneipe „Altes Haus“ in Jameln, der sich jahrelang die Erzählungen der Ehemaligen von „Stern“ und „Spiegel“ und „Zeit“ anhören musste, die nach dem vierten Bier erneut die Welt verändern wollten, diesmal halt die vor ihren Zweitwohnsitzen auf dem Land. Irgendwann hatte er wohl das Gerede von „Man müsste mal …“ satt, besorgte Anzeigen für die Finanzierung des Heftes und nahm dann seine Gäste beim Wort. Mit Erfolg. Inzwischen wird er bei Verlegertreffen neben den Großen platziert und grinst sich was, wenn sie von der Krise reden.
In den ungeheizten Dachkammern des Hauses Journalisten GmbH hausen all die Unbeugsamen mit einer altmodischen moralischen Grundhaltung, die ihren Beruf lieben wie an jenem Tag, als sie zum ersten Mal ihren Namen gedruckt lesen durften und heute kaum noch davon leben können. Auch sie haben einst davon geträumt, den Kisch-Preis zu gewinnen oder Chefredakteur zu werden. Aber wenn durch einen ihrer Artikel die Grünphase an der Fußgängerampel vor dem Altenheim in Dingsda verlängert wird, haben sie immerhin konkret die Welt verändert.
In den vornehmen Etagen, einst bewohnt von jenen Männerbünden, die trotz aller ihrer ideologischen Differenzen Frauen nur als Heilige oder als Hure akzeptierten, pfeift inzwischen der Wind des Wandels durch die Fensterritzen. Ein kalter Hauch war früh zu spüren, aber die Mitglieder der journalistischen Champions League hielten ihn für einen Luftzug vom Lift, den sie benutzten in die Tiefgarage, wo ihre Dienstlimousinen standen. Jetzt ahnen sie, dass ihre Leitartikel über die Krise des Journalismus künftiges eigenes Leid beschreiben könnten. Und Gott behüte sie, am Ende entscheiden darüber auch noch Frauen!
Gejammer auf hohem Niveau
Auf hohem Niveau wird gejammert, statt die Anzeigenrückgänge in zweistelliger Prozentzahl und die Auflagenschmelze der Printmarken als spannende Herausforderung zu begreifen und mit Kreativität und Wage-Mut in die Schlacht zu ziehen. Beklagt wird das Blut der anderen, die „freigesetzt“ wurden und seit Jahren mit schamlos niedrigen Honoraren von genau jenen abgespeist werden, die jetzt staatliche Subventionen für das Kulturgut Journalismus fordern. Talentfreie Planstellenbesitzer knechten begabte freie Autoren, so wie längst üblich in geschlossenen Fernsehanstalten, und hoffen bei der nächsten Rationalisierung von den Flanellfrauchen verschont zu werden.
Viele Journalisten haben ihre Zukunft schon lange hinter sich, weil sie nie bereit waren, sich für Qualität zu quälen oder sich von Wolf Schneider quälen zu lassen. Wer noch immer nicht begriffen hat, dass Glück der Moment vor dem nächsten Unglück ist, aber Unglück auch nur der Moment vor dem nächsten geglückten Satz, der nächsten geglückten Headline, der nächsten gestiegenen Auflage, wird plötzlich erwachen und auf leeren Fluren unruhig wandern, wenn die Blätter um ihn herum nur so fallen.
In Gefahr und Not bringt Jammern auch nur den Tod. Lieber aufrecht kämpfend untergehen. Was Besseres, siehe jene vier tierisch Tapferen, die als Bremer Stadtmusikanten legendär wurden, findet sich allemal.
Dieser Text ist zuerst beim „Tagesspiegel“ erschienen.
